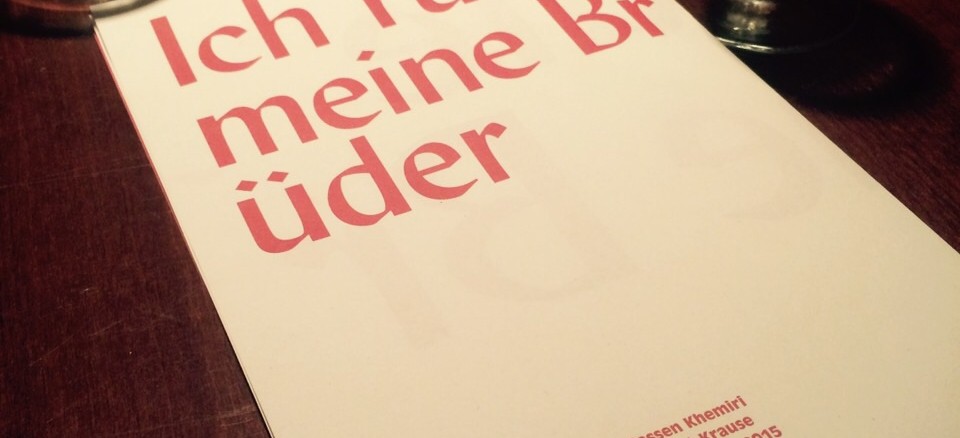
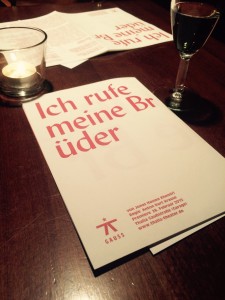
Foto: Jonas Dienst
Schade ist das, dass die Thalia Gauß Garage nur Platz für so wenige Besucher bietet. Wer „Ich rufe meine Brüder“, das kluge Kammerspiel einer Realitätsverschiebung, ansehen möchte, muss schnell sein, um eine Karte zu ergattern. Aber beginnen wir von vorn.
Anton Kurt Krause und seine zwei Schauspieler brauchen nicht viel. Ein abgeklebtes Spielfeld in der Mitte der Bühnenbreite, eine Installation aus schwarzen Reisetaschen links davon und ein Klavier. Pascal Houdus lässt einen ferngesteuerten Helikopter kreisen, als das Publikum zum Sitzen kommt. „Verhaltet Euch in den nächsten Tagen ruhig“, empfiehlt er, nachdem er das Spielzeug in eine der Taschen geräumt hat. Denn es scheinen schlimme Ereignisse bevorzustehen, aber wir, so versichert er uns, haben damit nichts zu tun.
So einfach das Setting, so klar das Zeichen. Eine Reisetasche ohne Besitzer am Flughafen bedeutet Sondereinsatz und Evakuierung. Eine Reisetasche ohne Besitzer steht für Terror. Sie steht aber auch für die Wahrnehmung einer Welt, die in diffuse Panik ausbricht vor einem Gefühl der Ohnmacht, vor Unwissenheit und Vorurteilen. Wer steckt dahinter, oder anders: Was steckt da drin? Genau das fragt sich Amor, der junge Protagonist aus Jonas Hassen Khemiris Stück. Allerdings hat er keine Angst vor dem Anschlag. Er hat Angst davor, ihn selbst verübt zu haben.
Für Amor verschiebt sich die Realität. Gerade noch war er betrunken tanzen in einem Club. Dann explodiert in Stockholm eine Autobombe, und er geht nicht ans Handy; denn es ist sein Freund Shavi, und der hat seit der Geburt seiner Tochter nur noch Babybrei im Kopf. Und plötzlich fühlt Amor sich als Terrorist. Nicht etwa, weil er verdächtigt würde, sondern weil seine Realität ihm keine klaren Zeichen mehr sendet. Oder die falschen, und davon zu viele. Schließlich passt er ins Raster: ein junger Mann mit Migrationshintergrund, der allein aufgrund seines Äußeren den Anschlag verübt haben könnte. Nicht mehr. Aber weniger eben auch nicht.
Amor fehlt die Spiegelung von außen, die ihn seine Paranoia überwinden ließe. Seine Cousine spricht am Telefon vom „eisigen Wind, der über dich und deine Brüder hinwegfegen wird“, und schon steigt der Bühnennebel auf zwischen den Reisetaschen. Alicia Aumüller, kongeniale Bühnenpartnerin von Houdos, legt am Klavier ein grandioses „Wind of Change“-Cover von den Scorpions hin. Überhaupt ist Krauses Version des Stückes geprägt von diesen ironischen und komischen Brüchen, die Houdos und Aumüller mit ausgezeichnetem Timing setzen. Dass sie dabei viel selbst machen, das Licht dimmen, den Nebel anstellen, das Rolltor öffnen, die Kamera auf sich richten, steht dem Text gut. Die Bilder, Szenen und Ängste, die Amor verunsichern, erzeugt er schließlich auch selbst.
Auch Valeria, seine große Liebe, will nicht mit Amor abhauen. Zwar darf die Welt kurz rosa werden, wenn er mit ihr am Telefon spricht, und eine Musicalnummer beschwört die ewige Liebe herauf. Aber ein Teil der Gleichung stimmt nicht. „Amor, du warst doch dieser Chemie-Nerd, der eine Frau gestalkt hat, bis sie die Stadt verlassen musste.“ Wir verstehen, so war das also. Die Welt zwischen Innen und Außen, Amors Wahrnehmung einer romantischen Liebe und das, was wirklich geschah, sind nicht mehr deckungsgleich. Es braucht eine Weile, bis man das im Lauf des Abends begreift, dafür kommt die Einsicht umso heftiger. Wir nehmen ausschließlich Amors Welt wahr. Und die ist weit entfernt von der Realität.
Auch wenn Houdos sich in das klischierte Abbild eines Islamisten verwandelt und sich mit Maschinenpistolen behängt, wird schnell deutlich: Diese Sicht auf sich selbst findet im Kopf der Figur statt. Sie hat ihre Wurzel in Vorurteilen, denen er begegnet, und der nicht unkomplizierten Situation einer Identität, die aus zwei Kulturen kommt und keine Zugehörigkeit findet. Konsequenterweise hat Krause die Personenanzahl des Stückes von vier auf zwei reduziert. Zwei Ausnahme-Schauspieler, eine Spielfläche von ein paar Quadratmetern und ein klares Konzept – mehr braucht dieser Text eben nicht. Ein geschickt gearbeiteter, komischer und zugleich tieftrauriger Abend, der uns mit der Frage entlässt, was unser Blick auf andere erzeugen kann. Es lohnt sich also, schnell zu sein für die Thalia Gauß Garage.


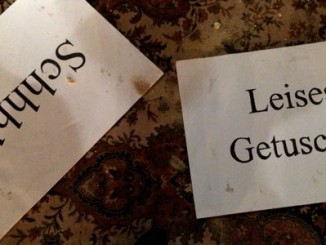
Sehr plastischer und anschaulicher Kommentar; man kommt sich vor wie im Stück! Wäre nicht die 800km-Distanz von MUC nach HH, säße ich morgen in der Thalia Gauß Garage, um selbst hautnah zu erleben.
MF aus München