Ein Raum, endlich mal wieder ein Raum – die Hinterbühne abgegrenzt durch einen hohen mehrreihigen Wall von Kleidern (»… the suits of woe?«, ein dunkel-rotter Bohlenboden, ein toter Hirsch, angeseilt. Das Seil reicht im Bogenschwung bis in den Bühnenhimmel, gliedert wie bei Piranesi die Tiefe. Und dunkel, farblos, düster. Alles. Auch wie dort. Durch den Wall treten alle auf, schauen hindurch wie durch den Blätterwald einer Hecke.
Auch Hamlet trägt sein dunkles Gewand – »his inky cloak«. Der hockt am hinteren Rand am Fuße dieser Kleiderhecke, während Gertrud und Claudius in groteskem Paarlauf hin zur Rampe gleiten. Wie ein armloser Buddha thront der Prinz, von dunkler Stoffmasse umhüllt, nur das gekrönte Haupt schaut heraus.
Dieser Hamlet ist kein mager Hadernder, sondern umgeben von der Stofflichkeit seiner Trauer und des Zweifels. Die körperliche Masse ist Behälter für zwei Innenleben, Hamlet ist zwiefach. Der große Schauspieler Joseph Ostendorf gibt den einen Part, der ebenso agile wie präzise Jörg Pohl den anderen. Nicht einfach hat sich Luk Perceval diese Trennung der »zwei Seelen« gemacht, keine banalpsychologische Trennung von Vernunft und Leidenschaft liegt dem zugrunde. Mal driften diese …, nun, nennen wir es mal … ZUSTÄNDE … auseinander, mal echoen sie um die Wette, ringen um die Vorherrschaft im Körperkleide, um sich zum Ende hin ganz voneinander zu lösen. Hamlet ist auf dieser Bühne ausdrücklich keine »gespaltene« Persönlichkeit, die Nähe zum Wahn liegt in diesem Wort zu nahe.
Ja, die Worte – Perceval hat eine neue Sprache für Hamlet gesucht. Übersetzt – oder wie es Programm vermerkt ist, »neu bearbeitet«– hat es Feridun Zaimoglu, gemeinsam mit Günter Senkel. Zaimoglus Sprache ist von einer heftigen Musikalität geprägt, wer diesen Autor einmal aus seinen Werk hat lesen hören, versteht das ziemlich genau, ungeheuer präzise sind Rhythmik und Diktion. Der Duktus bleibt permanent präsent in dieser Übertragung, kein verklärender Schlegelton, kein konkreter Brasch. Das Thema Musik ist auch ein eigenes – im Graben steht ein Klavier, das in den zwei Stunden der Aufführung durchgängig traktiert wird.
Der Pianist und Sänger Jens Thomas hat eine weitere Spur unter und durch den Text gelegt – und nein, es ist wirklich kein »Soundtrack«. Das Rezensentennotizbuch dieses Abends gab so einen Einfall wie »Seelengesang« her und das trifft es auch.
Von romantisch-verklärender Seele ist da allerdings keine Rede, bis zum Unaushaltbaren, zum Schmerzhaften werden Stimme, Klavier und Gitarre traktiert, man hört Stimmen, die den Schädel sprengen möchten. Noch eine Innenschau Hamletscher Welt, die die Welt des Sprachlichen bisweilen völlig verlässt, und – seltsame Parallele – wie im Musical das Unsagbare vertont.
Berichten könnte man noch von theatralen Bravourstücken wie die Reduktion der Schauspielerszene auf eine einzige Person, nicht einmal die Gaukelei darf in dieser Percevalschen Welt existieren. Oder von doppelt duplizierten Ophelien, die wie die Rheintöchter aufgereihte blaue Kleidchenträgerinnen mit vergehend hohen Stimmchen den Untergang zelebrieren. Alles andere sollte man selber sehen und nicht nachlesen. Zum Schluss der Hirsch: »Why, let the strooken deer go weep …«
Ja, der auch. [space size=80]


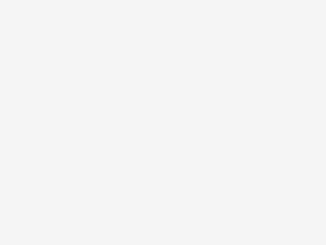

1 Trackback / Pingback