
Gleich vorweg: Auch in Stefan Puchers Inszenierung warten am Schluss alle immer noch auf Godot. Soweit alles wie gewohnt – der Rest der Neuinszenierung des Becket-Klassikers »Warten auf Godot« erscheint eher ungewohnt: Estragon und Wladimir, kurz Gogo und Didi, in Hartz-IV-Optik, Pozzo in Jeans mit halblanger blonder Mähne und Ledermantel, sein Diener Lucky komplett in Schwarz verhüllt und mit allerlei Gegenständen behängt, die er für seinen Herrn sinnlos über die Bühne schleppt.
Schon die Kostüme (Tabea Braun) und Video-Einspielungen (Meika Dresenkamp) erzeugen eine groteske, hoffnungslose Stimmung und lassen viele Assoziationen zur Gegenwart zu: Flüchtlinge, Gewalt, IS, Abu Ghraib, die Verhüllung von Menschen als Entmenschlichung von Opfern oder als schlichte Burka interpretiert etc.
Die vier Schauspieler, Jens Harzer als Wladimir, Jörg Pohl als Estragon, Oliver Mallison als Pozzo und Mirco Kreibich als Lucky sind den gesamten Abend über durchweg stark und machen die Sinnlosigkeit ihres Daseins greifbar. Kurze Passagen im Hamburger Schnack, pathetische Deklamation oder das dreimalige Hose-Runterlassen in den ersten zehn Minuten stehen zunächst kontextlos im Raum. Absurd eben. Und da »Warten auf Godot« ja genau das sein soll, macht das auch wieder Sinn.
Die Dialoge führen gewohnt ins Leere oder zumindest aneinander vorbei. Wenn beim wiederholten Nachfragen immer noch nicht die richtige Antwort gegeben wird, möchte man am liebsten aufspringen und selbst die Antwort rausschreien – selbst wenn man sie zugegebenermaßen auch nicht hat –, um die beiden Antihelden endlich aus ihrer Monotonie zu befreien. Unterstrichen wird diese grausame Eintönigkeit durch eine Wüste an feinsäuberlich gestapelten Euro-Paletten (Bühnenbild: Stéphane Laimé), auf denen die orientierungslosen Figuren Becketts – Peiniger, Flüchtlinge, ahnungslos, wegsehend, quälend, leidend – herumtrampeln. Dass die unterschiedlichen Protagonisten dadurch sinnbildlich auf Europa herumtrampeln, erscheint vielleicht auf den ersten Blick plakativ, ist aber gleichzeitig so subtil, dass es fast übersehen werden könnte.
Die Verlagerung in die Gegenwart und die diversen Anspielungen geben dem Stück eine unangenehme Aktualität, die es greifbarer macht und beim Publikum mit ihrer Drastik punkten kann. Allerdings gehen dadurch natürlich auch Interpretationsebenen und Assoziationsräume verloren.
Was machen wir hier überhaupt? Was ist der Sinn des Lebens? Wie war das mit unseren Zielen? Diese und andere Fragen kommen in Puchers Inszenierung zwar wiederholt ans Tageslicht, werden aber durch Flüchtlings-Dramatik und IS-Terror schnell wieder verhüllt. Verhüllt wie der Körper des zum Gegenstand degradierten Dieners Lucky, der immer wieder von seinem cholerischen Herrn Pozzo grundlos geprügelt wird. Wie soll man sich bei der Konfrontation mit so viel Gewalt auch noch um den Sinn des Lebens kümmern, wenn doch das Hin- und gleichzeitige Wegschauen nicht nur Gogo und Didi sondern auch das Publikum schon genug überfordern?
Godot wurde als Inbegriff für Gott, für Schleuser der Résistance, für den Sinn des Lebens, kurzum für die Suche nach Transzendenz verstanden und inszeniert. Zwar hielt sich Beckett selbst immer bedeckt darüber, was er mit dem Stück eigentlich aussagen wollte, es zeigt sich jedoch deutlich, dass viele Richtungen der Interpretation möglich und gewünscht sind.
Pucher setzt mit seinem Godot neue Schwerpunkte und macht diese Inszenierung vor allem durch die absolut überzeugenden Darsteller auf zu einem sehenswerten Theatererlebnis. Seine Neuinszenierung der absurd öden Dialoge lässt genug Raum für Situationskomik, bei der einem das Lachen aufgrund der Sinn- und Ausweglosigkeit häufig im Hals stecken bleibt. Gekonnt dosiert erzeugt er dadurch ein beklemmendes Unwohlsein. Auch wenn vielleicht einige Wünsche offen bleiben – wir warten ja auch immer noch auf Godot.
Ob das abschließende »Komm, wir gehen« als nahezu kitschige Erlösung des Publikums oder als sinnstiftende Komponente für das gesamte Stück zu interpretieren ist – darüber lässt sich streiten.


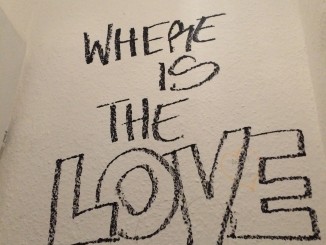
Hinterlasse jetzt einen Kommentar