
In einer windigen Einöde turnt ein Mädchen am rostigen Geländer. Watteweiß ist der Boden, und sie trägt doch nur eine Trainingshose mit Kapuzenjacke. Das Kind muss doch frieren, denkt man. Aber das tut es nicht. Eiskalt ist das Ding. Katzen wird es aufhängen im Laufe des Abends und Frauen ertränken. Vom Dämon besessen ist es, und der Vater wird erzählen, dass seine Frau nach einem Reaktorunglück schwanger wurde. Das Kind, es wollte nicht hinaus in diese Welt, nach elf Monaten habe man es geholt. Herausgeschnitten.
Gruselig, denkt der Zuschauer, der schon Atombomben hat explodieren sehen auf der Leinwand und weiß, der Regisseur, er konnte den aktuellen Bezug nicht lassen. Aber was zum Teufel – Verzeihung! – zum Dämon hat das hier zu suchen? Das Böse, kommt es, sich zu rächen? Kommt es in Form eines Reaktorunglücks in Japan? Kommt es in Form eines stummen Mädchens, das alpträumt und dann schreit, schreit, schreit, das ansonsten stumm mit einer schwarzen Katze auf dem Arm über die Bühne streicht? Ein Mädchen, das russischen Revolutionären in der Sinnkrise sagen kann, was sie in der letzten Nacht geträumt haben, das immer wieder den Finger an die Lippen legt mit bedeutendem Blick ins Publikum. Ach, und es kann die Gedanken beeinflussen. Dafür legt es die schmale Hand auf den rasierten Revolutionärs-Schädel und hebt die andere Hand mit gerecktem Zeigefinger, als wolle es nach Hause funken in eine fremde Galaxie.
Aber zurück zum Anfang. Zwei russische Revolutionäre aus Dostojewskis Dämonen-Roman, Nikolai Stawrogin und Piotr Werchowenskij, treffen aufeinander an einem ehemaligen Flugplatz in den USA. So abgelegen und gottverlassen ist es dort, dass man eher Sibirien vermuten würde. Hier gibt es nichts außer einem rostigen, verglasten Wachturm-Häuschen und einer Art freistehendem Treppenverschlag, unter dem der Vater des Mädchens mit der Kleinen haust. Da kann man hinaufsteigen und sehen, wenn sich jemand nähert, auch aus großer Ferne. Die Bühne ist ohnehin ein Geschenk (Ausstattung: Márton Ágh). Nicht nur, dass sie in ihrem verrotteten, verrosteten Zustand das kaputte Innenleben derer spiegelt, die auf ihr streiten, rennen, saufen, schreien, beißen, leiden, vögeln und verletzen. Sie ist auch von solcher Schönheit und Einsamkeit, dass man sich in ihrer Betrachtung schon mal verlieren mag, wenn einem das Bühnengeschehen zu bunt wird.
Die Revolutionäre jedenfalls treffen sich, um ein großes Attentat abzuschließen, soviel versteht das geneigte Publikum. Piotr kommt mit seinem Gehilfen Iwan Schatow, beide sind voll wie die Eimer mit russischem Wodka. Wenn so die Revolution aussieht, na, dann gute Nacht. Aber Piotr und Iwan, sie brennen. Sie brennen für die Sache und wollen sich bei dem Attentat in den Tod stürzen. Nikolai verehren Sie wie einen Messias: »Sie sind der neue Führer einer neuen Welt. Und ich werde Ihnen mit meinem Körper den Weg öffnen.« Nur aus diesem Grund lassen sie sich sogar eine Frau als Fluglehrerin vor die Nase setzen. Franziska Hartmann als Lisa Lebjadkina hat die Hosen an. Alles was sie auf der Bühne tut, tut sie zu 100 Prozent. So liebt sie ihren mageren Revolutionär Nikolaj, dem die Revolutionsidee abhandengekommen ist. So arbeitet sie mit den abgehalfterten Ko-Revolutionären am Flugsimulator. So schüttet sie den Kartoffel-Wodka in sich hinein, als gäbe es kein Morgen. So leidet sie an der Liebesunfähigkeit Nikolajs, verbeißt sich in seinen Hals, bis das Blut rinnt, lässt sich schlagen, verletzen und demütigen von den verrohten Männern. Und so ficht sie letztlich ihren Todeskampf, lang, kraftvoll und (beinahe) unbeugsam.
Überhaupt gibt es einige wunderbare Momente auf der Bühne. Momente, in denen man merkt, dass da einer vom Film kommt, dass er simultan Dinge erzählt, die einander kommentieren und verschärfen. Wenn draußen beim Wodka über den (Un-) Sinn eines Selbstmord-Attentats philosophiert wird, über die Liebe zum Dasein und dessen Sinn-Losigkeit, übt drin im Aufsichtshäuschen der betrunkene Piotr am Flugsimulator. Innen auf die Rückwand projiziert, sehen wir durch die Glasscheibe hindurch, wie er das Steuer wild von oben nach unten reißt, sehen das Flugzeug abstürzen, sehen die Computer-animierte Explosion mit viel Rauch, Blitz und Kawumm. Piotr lacht. Schwitzt. Schreit. Säuft. Und draußen ein stiller Moment des Einverständnisses zwischen Lisa und Schatow, einer dieser betrunkenen Augenblicke, in denen man kurz das Gefühl hat, den Grund für diese Existenz greifen zu können. Und den Bruchteil einer Sekunde später stürzt er ab, der Gedanke, macht sich selbst zunichte, und es ist, als sei er nie gedacht worden.

Dennoch: So nah man sich ihnen manchmal fühlt, man versteht sie nicht, diese verzweifelt rennenden Kreaturen auf der sibirischen Bühne. Die Ideologie transportiert sich nicht. Man mag denken, das sei Absicht. Denn schließlich ist die Idee den Revolutionären abhandengekommen. Oder wie Nikolai es ausdrückt, als er das geplante Attentat abbricht: »Auf ein leeres Herz kann man nicht schießen.« Und sein Herz, es ist leer wie die Wodkaflasche im Schnee vor dem Wachhäuschen. Ohne Frage: Man sieht ihnen gerne zu, diesen wunderbaren Schauspielern. Und man begreift auch die Sinnentleertheit der fanatischen Idee. Aber den Teufel auf der Bühne, die Dämonen Nikolajs, die sieht man nicht. Man sieht ein schlaksiges Mädchen an der Grenze zum Teenager, das mit all der ihm möglichen Kraft versucht, seinen dünnen, fast durchsichtigen Körper zum Medium zu machen für das Unerklärliche. Aber es funktioniert nicht. Da hat die Regie sich verpokert. Dostojekwskis abgründige Magie sperrt sich – wie so oft – dagegen, sich auf die Bühne transportieren zu lassen. Und ein paar Atompilze, die projiziert werden, wenn der Vorhang fällt, können da leider auch nicht helfen.
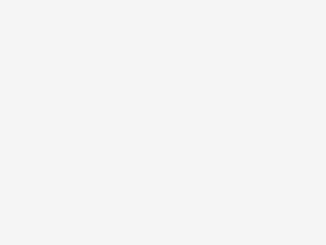


Vielen Dank für diesen aufschlusreichen Artikel.
Danke für diesen informativen Artikel!
Viel viel mehr über Dostojewski, in allen Belangen, können Sie hier finden: http://dostojewski.npage.de/