
Es gibt diese bezaubernde kleine Anekdote, dass der jüdische Kantor Sholom Secunda, als er mit seiner Frau spazierenging und diese über dieses und jenes und auch über ihr Aussehen klagte, er nur einen Satz zu sagen wußte: »Bay mir bistu sheyn«. Daraus wurde ein Lied und Patty, Maxine und LaVerne Andrews sangen es bis zu ihrem Lebensende.
Die ersten paar Ragtime-Takte sind ikonisch für das amerikanische Lebensgefühl der dreißiger und vierziger Jahre, die Zeit, in der die alte Welt von Diktatoren gebeutelt wurde und von der neuen gerettet werden sollte. Aus dieser Zeit stammen auch die Überhelden der amerikanischsten aller Literaturgattung, Comics. Captain America, Superman, Batman – alles Retter der Welt gegen Schurkerei und Größenwahn.
Und in der Regel verdanken diese Weltenretter ihre übermenschlichen Fähigkeiten – der düstere Ritter Batman ausgenommen – der Hoffnungstechnologie dieser Jahre, die schließlich auch das Kriegsende in ihrer über- und unmenschlichen Gewalt markierte, der Entdeckung der Kraft radioaktiver Strahlung, ein Wort, das Marie Curie erst wenige Jahre zuvor kreiert hatte.
Ganz und gar ohne Arg nahm man sich der neuen Energie an, dachte an saubere und immerwährende Kraft aus dem Nichts. Und fing an, Dinge zu nutzen, die strahlten. Daß eine Uhr im Dunkeln leuchten konnte, ohne dass eine Lampe darauf schien, war wunderbar und so gab es bald Fabriken, in denen Arbeiterinnen mit feinen Pinseln phosphoreszierende Farbe auf die Zifferblätter tupfte. Und wenn der Pinsel mal stumpf wurde, feuchtete man die Spitze zwischen den Lippen an, wie jedes Kind es mit seinem Tuschekasten macht. Die Frauen starben. Sie nannten sie Radium Girls.
Und was wäre, wenn die plötzlich die Stimme der American Wartime Girls, der drei Schwestern Andrews bekämen und dazu tanzten? Skurril? Vielleicht ein bißchen, aber wir sind inmitten der neuen Produktion der deutsch-schweizerischen Theaterensembles Mass & Fieber, inszeniert von Niklaus Helbling.
»Fall Out Girl« heißt sie und der Tanz der Radium Girls ist nur eine der unzähligen Nummern dieser kleine Revue, die sich aus dem Fundus amerikanischer Kulturindustrie bedient. Man muß sich schon ein bißchen auskennen oder hinterher nachschauen, um die tiefgestaffelten Verweise zwischen Comicwelt, Popkultur und Historie in Gänze zu durchschauen.
Fall Out Girl – der Begleiter des Superhelden Radioactive Man, den es wiederum nur im Universum der Simpson-Comics von Matt Groening gibt, heißt Fall Out Boy – jenes Fall Out Girl also ist das Alias von Mary Jane Watson, der Freundin von Peter Parker. Peter Parker ist Spiderman. Alles klar?
Jene junge Dame, Antonia Labs heißt die Schauspielerin von Mass & Fieber, begibt sich auf die Suche nach ihrem postapokalyptisch verschollenen Freund, an ihrer Seite der Musiker und Comicladenverkäufer (noch ein Verweis auf die Simpsons) Bartleby – ja, man denke auch an Herman Melvilles Zauderer – der im präradialen Zeitalter der Schauspieler und Musiker Johannes Geißer ist.
Der macht nicht nur die Bühnenmusik, sondern hat das, was nicht im American Songbook der Nachkriegszeit steht, zu großen Teilen selbst geschrieben.
Wer hier nun wessen Sidekick ist, ist indifferent und auch unerheblich für den Fluss des Stückes, das sich Revuenummer um Revuenummer nach vorne entwickelt, stets darauf bedacht, keine Pose adoleszenten Pseudostargetues zu umgehen und dabei auch keine Facette eines popatomaren Themenparks auszulassen scheint. Spidermann ist Unternehmer einer merkwürdigen Industriefirma, deren Werbejingles immer wieder mal eingespielt werden, und die irgendwas mit Rüstung und Spinnennetzen macht, es treten wahlweise und imaginierte Figuren aus Comics und der Literaturgeschichte auf, Lewis Caroll meets Marie Curie und so weiter und so fort.
Die Gitarren baumeln stets von mindestens einem der Hälse der beiden Darsteller herab, hier ein Dylan-Song, dort mal Love-Story-Thema. Ab und an wird ein Orson-Welles-Gott videographisch eingespielt, der Handlungsanweisungen und Lebensweisheiten von sich gibt. Irgendwann ist man im Kyffhäuser, in dem nicht Barbarossa, sondern Donald Duck thront, »ent«-sorgt, wie er kalauert. Und über allem schwebt ein riesengroßer, aufgeblasener Pikachu – ja, ein Pokémon, das elektrische Blitze verteilt. Bäng!
Und das alles funktioniert prächtig, es ist bunt, mal laut und mal leise. Die beiden Darsteller lassen es an nichts fehlen, singen und spielen sich lustvoll die Seele aus dem Leib, kaum kommt man einmal zu Atem ob des furiosen Tempos, das im letzten Drittel ein wenig nachzulassen scheint. Auf der Bühne sieht man übrigens neben den Beiden und allerlei graphic-reduziertem zweidimensionalem Requisitenkram nur ein einzelnes Versatzstück, einen Paravent, der als Projektionsfläche und für sonstige Prospektaufgaben genutzt wird.
In einem Land, in dessen Baumärkten die Geigerzähler ausgehen, wenn auf der anderen Seite der Erde ein Atomkraftwerk zerstört wird, ist die Haltung, die dieses Stück zeigt, längst überfällig.
Denn was da so großartig gelingt, ist die Entkleidung eines Dogmas, das sich inzwischen – vor allem in Deutschland – zu einer allein moralischen Kategorie entwickelt hat. Welche Hoffnungen und Visionen in der noch immer unbekannten Macht Radioaktivität gesehen wurden und welche Vorstellungen und Phobien diese generieren kann, all das ist ja auf der Bühne endlich in beiden Richtungen zu entdecken. Das ist wichtig, spektakulär und vor allem ungemein anregend für die thematische Auseinandersetzung, ohne das große Manko der Vereinnahmung durch dogmatische Fundamentalisten. Doch kein Glück ist perfekt.
Was man sich aber vielleicht noch wünschte, bei all dem großen Vergnügen am Virtuosen, am spielerischen Umgang mit den Topoi des Pop, mit den Visionen dieser imaginierten Strahlenwelt, wäre eine weitere Sphäre, die über den Gestus der Zweitverwertung, über das Zitat hinaus gehen kann. Das kann es nicht, dieses Stück. Das will es möglicherweise auch nicht. Und das muß es auch nicht, denn es ist tatsächlich eine Revue. Was schwerer wiegt, mag jeder für sich entscheiden.


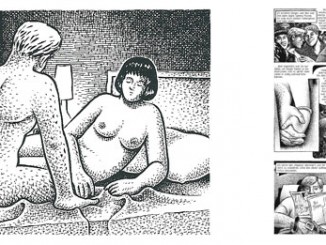
Hinterlasse jetzt einen Kommentar