
Chet Baker (Ethan Hawke) hat Sex. Da der Posterboy des Cool Jazz auf den Laken dann doch nicht so cool ist, sondern eher von stürmischerem Naturell, hält ihn seine hübsche, schwarze Freundin Jane (Carmen Ejogo) zurück und verlangt mehr Hingabe: »Pretend you’re playing me.«
Zuvor ist schon einiges passiert. Baker, der in den späten fünfziger Jahren, nicht zuletzt durch die Fotos des berühmten Fotografen William Claxton, so etwas wie ein Popstar wurde, hat seine große Krise erlebt. Er hat Bekanntschaft mit dem Heroin gemacht und seine Zähne verloren, und ist als Musiker in der Versenkung verschwunden. Das sind die Zutaten für das klassische Filmmelodram, der gefallene Held, gestrauchelt. Für die Läuterung des Helden braucht der Plot nunmehr die liebende und hingebende Frau, die den Helden wieder auf den Pfad der Tugend zurückführt, je nach Genre gelingt das nur temporär oder endgültig.
So hat auch kanadische Regisseur Robert Budreau sein Biopic über die frühen Jahre des bis heute verehrten Trompeters Chet Baker konzipiert. Er hat sich die dramaturgisch dankbare Phase im Leben des Jazzstars ausgesucht, jene Zeit Mitte der fünfziger Jahre verdichtet, die den Musiker zu Fall brachte, in der er sich immer weiter im Drogenkonsum verlor. Die Geschichte, die Budreau inszeniert, ist eine eher freie Interpretation der bekannten Fakten, die rettende Frau ist eine Erfindung, die Verdichtung der Ereignisse zwischen Drogenabhängigkeit, dem Verlust des Gebisses, der das Spielen unmöglich machte und dem Kampf um die Anerkennung bei seinen schwarzen Kollegen, hat so nur sehr bedingt stattgefunden.
Im Film ist das alles stringent, der weiße Junge aus Oklahoma mit dem großen Talent, ringt um die Anerkennung seiner Idole, er darf mit Charlie Parker spielen, er tritt in dem nach ihm benannten Club auf, dem berühmten Birdland – und hier muss er sich seinen Idolen stellen, Miles Davis und Dizzy Gillespie. Miles Davis, der eine bekannt kritische Haltung zu weißen Jazzmusikern hatte, tritt hier als Scharfrichter auf und senkt seinen Daumen: »I never trust a cat who’d let loot or love affect his art. … Come back if you’ve lived a little.«
Und Baker bricht auf ins Leben, verfällt der Droge. Beim Anbahnungsmeeting mit der neuen Freundin Jane, wird er von seinen Dealern überfallen, sie schlagen solange auf ihn ein, bis alle Zähne verschwunden sind. Jane bleibt bei ihm, pflegt ihn und reist mit ihm zu seinen Eltern auf die heimatliche Farm, hier kommt es zur nunmehr folgerichtigen musikalischen Kopulation, sie bringt die Erziehung zur Läuterung in Gang: »Pretend you’re playing me.«
Die weitere Narration folgt dem angezeichneten Muster: Wiederauferstehung durch das Jammertal – der Held wird bei seinem Comeback zunächst nicht erkannt und zum Üben geschickt – familiäres Glück mit der liebenden Frau, dann die Wiederentdeckung von Talent und des vergangenen Mythos des Helden. Kurz vor der Rückkehr zum Ort des eingehenden Traumas, dem Birdland, trifft er erneut auf Gillespie, der zwar den Kraftakt zur Erringung der zweiten Chance bewundert, aber nicht allzu viel vom »neuen« Baker hält: »Makes for some ragged phrases, but your playing is …« Der aber spricht die Worte, die auch jeden Dilettantismus adeln: »Honest. It’s honest.«
Mit solchen Wahrhaftigkeitsphrasen rettet sich Budreau in die letzte Runde der Heldenreise, Baker reist ohne seine Freundin von den lauen Lüften Los Angeles zurück in den Morast der Großstadt New York, ins Birdland. Die Zuspitzung erfolgt, das bislang stabilisierende Methadon fehlt, sein in Freundschaft verbundener Produzent Dick Bock (Callum Keith Rennie) verschafft die Ersatzdroge, inzwischen aber liegt auf dem Garderobentisch schon der Heroinlöffel. Beide Optionen sind vorhanden, Baker, der sich gegen das Methadon entschieden hat, weil er glaubt, das Heroin mache ihn zum besseren Musiker (»I can get inside every Note.«), tritt auf auf die Bühne, spielt, Miles Davis klatscht. Die Heldenreise ist vollzogen, der kurzfristig Geläuterte ist wieder dort, wo der wahre Künstler hingehört, in den Rausch, in die Verzweiflung, und die künstlerische Enthemmung. Natürlich wendet sich die liebende Frau ab.
Ethan Hawke in diesem Film beim Method Acting zuzuschauen, ist durchaus vergnüglich, das Dekor hübsch liederlich in seiner Zeit verortet, da lassen die Mad Men grüßen, bis hin zur dauerhaft qualmenden Zigarette. All das unterhält und ist ansehbar, die Verdichtung in der fiktiven Geschichte schafft eine möglich scheinende Idee vom Leben des berühmten Musikers und verfällt aber zugleich der großen bürgerlichen Legende von der Welt der Kunst.
Die nämlich erklärt die Genese künstlerischen Schaffens aus dem Unverständnis des Kreativen, aus der Abgrenzung von der Welt des Künstlers und seiner Erhöhung. Denn der Künstler kann in dieser Polarisierung nur außerhalb seiner Gesellschaft stehen, wahre Kunst kann nur aus dem Dilemma entstehen. Diesem Mythos sitzt eine ganze Branche auf, es hält sich auch in den Feuilletons, dass »echte« und »wahrhaftige« Kunst nur aus der Entgrenzung entstehen kann. Das geht hin bis zur Aburteilung von Künstlern, die diesem Bild des gequälten Kreators nicht entsprechen, der Vorwurf des unauthentischen, weil nicht leidenden Künstlers liegt stets in der Luft.
Der reale Musiker Chet Baker eignete sich vorzüglich zu solch eine Mythenbildung, ungeachtet der Tatsache, dass er schon vor seinem »Fall« ein gefeierter Star von hohem künstlerischen Potential war. Vergleicht man die Aufnahmen vor und nach seinem Comeback, fallen einem vor allem die technischen Unterschiede auf. Der frühe Baker ist brillant im Ton, prägnanter und direkter in seiner Melodieführung, der späte Interpret hat vor allem Mühe, den Ton zu halten, es zischt und pfeift allerorten, dennoch erscheinen trotz der technischen Mängel seine Improvisationslinien einfallsreicher. Aber es kann keineswegs die Rede davon sein, dass der Drogenkonsum den Musiker geadelt hätte, gar »authentischer« gemacht hätte. Im Gegenteil ist es eher so, dass trotz all der Einschränkungen die so verehrten späten Einspielungen entstehen konnten.
Schaut man aus der Distanz auf einen anderen Film über das Leben dieses Musikers, Bruce Webers Dokumentarfilm »Let’s get lost«, erlebt man dort vor allem in der Schlußszene einen durchaus zufriedenen Menschen, der ganz offenbar trotz seiner Abhängigkeit mit seiner Musik und seinem Leben zurechtgekommen ist. Gedreht wurde »Let’s get lost« Ende 1987. Mit 58 Jahren, nur ein halbes Jahr später, fiel Chet Baker aus dem Fenster eines Amsterdamer Hotels, die Trompete in der Hand, das Hotelzimmer und den Körper voller Drogen, er starb auf dem Pflaster. »All I wanna do is play.« sagt die Figur in Budreaus Film. Das mag gestimmt haben.

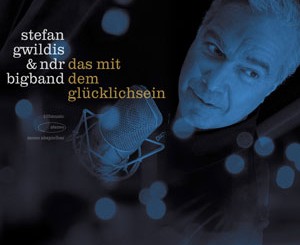

Hinterlasse jetzt einen Kommentar