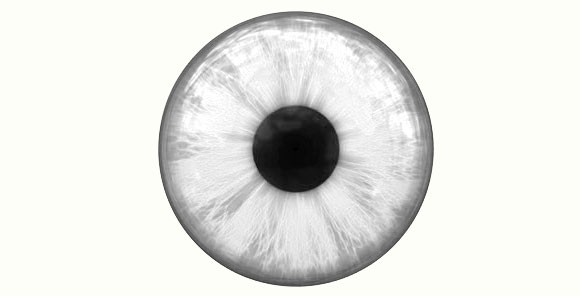

Krumm steht er da, gebeutelt, geblendet, gebrochen: Ödipus, ein Bettler, der auf dem Hügel von Kolonos die Athener um Asyl bittet. Ein Heimatloser ist Markus John mit verdreckter Hose, speckiger Jacke und strähnigem Haar. Und der Chor der feisten Athener (grandios in groteske Fett-Suits verpackt von Kostümbildnerin Martina Küster) weiß nicht genau, ob er den grantelnden Penner haben will. Entsetzen erfasst die selbstzufriedenen Dicken, als sie seinen Namen vernehmen. Erzählen soll Ödipus sein Schicksal am Abgrund.
Bühnenbildnerin Cora Saller findet treffsicher ein Bild voller Abgründe für Ödipus´ Leben der blinden Fehltritte: Die Bühne eine löchrige Fläche mit bruchstückhafter Podesterie, aus deren Tiefen das spielfreudige Ensemble je nach Bedarf über Leitern aus der Unterbühne hervorklettert. Der einzige, der unbeweglich verhaftet bleibt an einem Ort, ist Ödipus. Der lässt sich von den Athenern überreden, sein Leben zu erzählen. Für die Rückblende legt er sich die schwere Goldkette des Königshauses von Theben um und beginnt, sich auf der Bühne zu verwandeln. Doch nimmt er keineswegs die hautfarbenen Pflaster von den Augen, um zu Ödipus vor der Blendung zu werden; vielmehr klebt er sich Augen auf und wird somit zum Inbegriff des tragischen Ödipus: Ein Sehender ist er nun und dennoch blind, und die Geschichte beginnt.
»Krank ist die Stadt!« schreit es aus der Unterbühne, bevor das Volk aus seinen Löchern klettert, weiß geschminkt, schwarz gekleidet wie aus einem kafkaesken Alptraum. Es fordert die Hilfe des Mannes ein, der die Stadt einst vom Fluch der Sphinx befreite, ohne zu ahnen, dass der doch die Ursache allen Übels ist. Den (eigentlich) blinden und greisen Seher Teiresias besetzt Buddeberg konsequent – und etwas zu gewollt gegen den Strich – mit einem Knaben. Weiß gekleidet und gefärbt von Kopf bis Fuß steht der von Schwager Kreon um Rat Gefragte als pure Unschuld und spricht den Satz, der Ödipus, das Genick bricht: »Der Mörder, den ihr sucht, bist du.«
Und so nimmt das Schicksal des Ödipus seinen Lauf. Er ist einer, der sich selbst entblättert, seine Schuld in detektivischer Kleinarbeit gnadenlos offenlegt. Doch keine Suche nach Identität bleibt ungestraft, und so spricht der Knabe Teiresias denn auch: »An diesem Tag wirst du geboren, und du stirbst.«
Ödipus´ Entdeckerwillen entgegen läuft die Verhüllungs- und Verdrängungstaktik seiner Gattin (und Mutter) Iokaste. Irene Kugler spielt das Begreifen so körperlich, so plastisch, dass es zum Schneiden dick im Raum steht. Als sie an seinen Knöcheln erkennt, dass es sich bei ihrem Mann um ihr eigenes Kind handelt, das sie einst aussetzen ließ, um dem Orakelspruch von Delphi zu entkommen, knickt ihr Körper ein, als hätte man einer Marionette die Fäden durchtrennt. »Wenn dir an deinem Leben liegt, forsche nicht weiter«, fleht sie und weiß doch, dass sie sich vergebens auflehnt gegen die Macht des Schicksals.
Das Ende ist Jammer, Projektion mit Musik und die Blendung des Ödipus. Dass das Bild der Blendung mit spritzendem Blut ein bisschen heftig gerät, und der eine oder andere Lacher im Zuschauerraum zu hören ist, tut dem Abend keinen Abbruch. Ein starker Schluss wäre das. Doch vertraut das Leitungsteam dem Ende der bislang starken Mischfassung aus Sophokles´ Alterswerk Ödipus auf Kolonos und dem bekannteren König Ödipus nicht.
Im Schnelldurchlauf wird die weitere Geschichte des Artridengeschlechts entwickelt. Inhalte aus Euripides´ Die Phoinikerinnen, Aischylos´ Sieben gegen Theben und der Antigone des Sophokles werden hier verwoben – nicht umsonst schiebt Dramaturgin Nicola Bramkamp im Programmheft die »Gedanken zur Textfassung« hinterher. Denn was nun geschieht, wirkt gestückelt und beliebig und wie im schnellen Vorlauf eines Films. Das gönnt man der bislang besonnenen Inszenierung eigentlich nicht, dass der Rest der Geschichte wie in einem Wurmfortsatz hintendran gepackt wird. Was Buddeberg in dieser Inszenierung – ebenso wie bei der Möwe der letzten Spielzeit – nämlich schafft, ist eine ausgezeichnete Schauspielerführung, eine packende Bildphantasie und eine exzellente Musikauswahl (Musik: Stefan Paul Goetsch).
Und so findet sie am Ende den Bogen zurück zu Ödipus, der am Bühnenrand sitzt und das wild-brutale Treiben seiner Kinder »beobachtet«. Die letzten Sätze gehören ihm, und so stellt er, ganz ohne große Bilder, in die Stille hinein die Frage nach der menschlichen Selbstbestimmung. Mit der ist es bei den Griechen nicht weit her. Stille. Und Dunkel.



Hinterlasse jetzt einen Kommentar