
Warm steht die Luft über den Pflastersteinen an diesem Abend, vergessen ist dieser Sommer, der keiner war. Ein dunkler Kleinwagen parkt im Schein der Straßenlaternen, mit geöffneter Hecklappe in einer Parkbucht, im Kofferraum lagern Weinkühler und Blechkuchen. Und um den Wagen stehen Bürger in angeregter Unterhaltung umher, ein paar Dutzend andere flanieren mit aufgeklappten weißen Lunchboxen auf dem Platz herum. Dazwischen eilt ein Mann im Hochzeitsbitteranzug mit Blumengesteck am Revers durch die Menge. Es dies ist nicht Glyndebourne, es ist auch keineswegs Bayreuth, all die kauenden und redenden Menschen machen Pause, der Mann mit der Blume heißt Nicolas Stemann und er ist Regisseur. Es ist die erste Pause seines achtstündigem Faust-Doppelschlags am Thalia-Theater in Hamburg, vom Haus eigentümlich sportlich metaphernd als »Faust-Marathon« verkauft. Denn sportlich ist außer Nicolas Stemanns Eile nichts, hier, an diesem wohl letzten Sommerabend des Jahres.
*
Dem Sommeridyll vorausgegangen war des Dramas erster Teil, der herauf, herab und quer und krumm gespielte, der alte Zugochse des deutschen Gymnasiallehrers. Die Geschichte ist so bekannt, der Holpervers so eingebrannt ins germanische Bildungsstammhirn, daß es eigentlich nichts mehr bedarf bei diesem Stück. Christoph Marthaler führte das 1993 vor, als er den großen Joseph Bierbichler nur noch »…a…e …u… a… …i…o…o……ie, …u…i……e…ei u…… …e…i…i…« lautieren ließ, eben die Wurzel aller Wirkungsgeschichte, aller Referentialität, aller Zitatenhuberei. Stemann ist an diesem langen Abend des Jahres 2011 von anderer mathematischer Disposition, ihn interessiert zwar die Reduktion, weniger aber das Ergebnis denn der Lösungsweg.
Viele Dinge werden da unwichtig. Abwesend ist das Bühnenbild, alles was man benötigt, ist immer da – mal die Schwelle für das »Pentagramma« samt dranhängender Tür, mal ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett. Es reicht aus. Man darf dies auf keinen Fall mit einer leeren Konzeptbühne verwechseln, mit der Konzentration vorgebenden Ödnis, wie sie in letzter Zeit wieder Mode geworden ist. Es ist einfach nebensächlich. Es gibt eine Übertitelungsanlage, die die Szenenangaben übermittelt, gelegentlich auch einen Subtext. Vier große Edelstahlpanele, je zwei an den Seitenportalen, die bei Musik- und Toneinsätzen vor sich hin vibrieren und auch noch weitere Bestimmung haben. Gelegentlich sind da Videoprojektionen auf der Hinterbühne zu sehen, schemenhafte Bilder aus dem Gegenreich, unprätentiös werden da zwei Projektoren auf die Bühne gerollt und hinterher wieder abgeräumt. Aus und fertig.
Noch viel unwichtiger ist die Anwesenheit von Faust- und/oder Mephisto-Stars. Es gibt keine ikonischen Schauspielerpersönlichkeiten, die in Interviews sagen, sie würden die Rolle ihres Lebens spielen wollen. Philipp Hochmair, Sebastian Rudolph sind alles und spielen alles, natürlich ausgezeichnet, der eine etwas physischer disponiert als der andere, ohne einen Gegensatz zu wollen. Später gesellt sich Patrycia Ziolkowska dazu, eine bisher gelegentlich leicht zu unterschätzende Schauspielerin; hier, auf dieser Bühne, in dieser Nacht, eine Darstellerin von ungeheurer Exzellenz und großartiger Uneitelkeit. Auch sie ist alles, ist das Stück, ist Faust, Mephisto, Margarete undsofort.
Verspielt ist es schon, was da die »kleine Welt« zeigt. Stemann entfernt sich überhaupt nicht vom Material, die Geschichte läuft konsequent linear, seine Einlassungen sind, zumindest in einer Ebene ebenso konsequent rezeptionskritisch. Es kann schon vorkommen, daß all das dräuende Schulrezitieren, die ungeheure »Bedeutung«, das Dichterfürstentum, das deutsche Nationaldrama und was da noch so alles dranhängt, schnell und knapp auf die Schulbank gedrückt werden, da sitzt dann Philipp Hochmair, die glühenden, elektrischen Hörnchen noch im Haar, mit den Fingern schnipsend auf dem Stuhl und weiß den Text. So schnell wird man den Deutungs-Ballast aus 200 Jahren für den Moment los, übrig bleibt das Spiel. Das große Interpretentheater bleibt aus, geradezu elegant wird dieser Kommentar dann, wenn, wie in der Walpurgisnachtszene die – und das ist am Theater, wo jeder Schauspieler mal so eben auch ein bisschen singen muß, selten – wirklich ausgezeichnete Sopranistin Friederike Harmsen Texte aus dem grünen Reclam-Erläuterungs-Heftchen singt. Solch differenziertes Spiel mit Bedeutungsebenen war selten, auch am viel- und hochdekorierten Thalia-Theater.
*
Der fortlaufende Gedanke, es handele sich in erster Linie um das Spiel gegen den über Dekaden eingepaukten Eindruck eines Stückes, ist einer der klügeren dieser Deutung. Nicolas Stemann weiß um den Ballast und thematisiert das auch. Das ist unendlich befreiend und läßt an die Substanz des Textes glauben, an eine Stärke hinter der schriftlichen, der literarischen Interpretation. Die kommt auch zu Wort, spät, tief in der Tragödie zweiten Teils. Auf den glänzenden Proszeniumsblechen und auf der Hinterbühne tauchen die Stimmen und Bilder des Schulfunks, der universitären Deutung auf, professorale Kommentare und Deutungen. Irgendwann verstummen sie, die Bilder laufen weiter, die Deutung und weitere textimmanente Interpretation verstummen mit den Worten. Übrig bleibt das Stück, die Ikonenhaftigkeit ist verschwunden, hier ist Katharsis, gar Freiheit. Da wird selbst ein Geheimrat zum Revolutionär.
*
Überhaupt das Stück. Es ist fehlbar, unzweifelhaft. Es fehlt dem Dramatiker Goethe an vielem, an der dramaturgischen Eleganz eines Lessing, an politischem Verlangen, wie es in Lenz brannte und an der gewaltsamen und gewaltigen Verve, mit der Kleist die Sprache tötete und wiederauferstehen ließ. Das erste Stück ist hölzern und unvollendet, das Zweite zerfasert, hochtönend, wirr gar und dem Spiele so gar nicht zugeneigt – dem Verdacht, daß die ganze Jahrmarktsbudenhaftigkeit, die das alles umhüllt, tatsächlich dem theatralen Horizont des Dichters entspricht, ist nie so ganz auszuweichen. Aber der Stoff scheint anregend, Gespensterspiele, Hybris, Triebhaftigkeit, Machtstreben alles drin, auch bei Stemann. Hin und wieder hat er einen starken Hang zu den Showbühnen dieser Welt, blutiges Geld (Dollarnoten mit Dichterfürstenkonterfei!) schwebt ins Parkett, aber so was steht natürlich auch in der goetheschen Bretterbude vortrefflich an. Der Spielleiter selbst führt in leicht verschämter Manier durch den Abend, deswegen der dunkle Anzug mit dem Sträußlein am Revers, nachgerade eine Persiflage auf den »erklärten« Text, den man anderweitig schon bewundern durfte. Auch die Übertitelung der Szenen tut das ihre zum Showbiz dazu. Erklär mich, ruft es, und das, was wir sehen, tut das Gegenteil davon.
*
Dazu kommt der Unsinn mit der Postdramatik, den so manch einer in Stemanns Wirken zu erkennen glaubt.
»Das Adjektiv ›postdramatisch‹ benennt ein Theater, das sich veranlaßt sieht, jenseits des Dramas zu operieren, in einer Zeit ’nach‹ der Geltung des Paradigma Drama im Theater.« – so steht das beim Theatertheoretiker Hans-Thies Lehmann.
Jenseits des Dramas, seiner Struktur und seiner Ästhetik ist nichts in diesem Faust. Der Regisseur hat auch hier – den Interpreten schon vorgreifend – ein zauberhaftes Rezept der Interpretationsvernichtung. Da sitzt dann eine geradezu bernhardtsche Figur da, eine Wagner-Variation in Rheumadecke, minettihaft dröhnend, und schwadroniert über die Erfindung des postdramatischen Theaters »damals auf Kampnagel, Videoprojektionen, erinnern sie sich, ich habe es erfunden – ich, der postdramatische Geheimrat«. Was ein Schlag!
Wenn dann noch die ganz wunderbare Barbara Nüsse den Geheimrat gibt – »Der ganze Faust – ungestrichen!«, Gustaf Gründgens als Stabpuppe auftritt und am Ende Faustens Seele nur eine dürre Plastiktüte ist, die ebenso wie vordem die Banknoten ins Publikum entschwebt, wenn alle mit dem schönen Schlußchoral »Am Weibe hängt’s, zum Weibe drängt’s« das Spiel beschließen, ist tatsächlich fast alles gesagt. Boy meets Girl, ok?
Und dann geht man hinaus in die stille, die letzte Sommernacht, und noch immer sind die Steine warm.



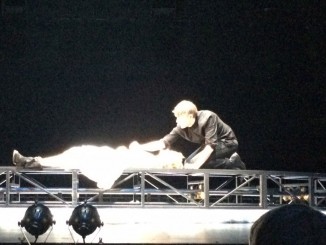

Hinterlasse jetzt einen Kommentar