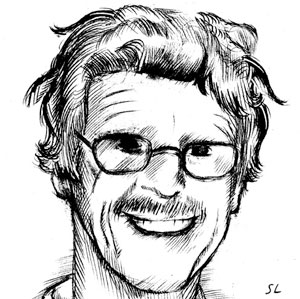
 Gegenwärtig ist die Empörung über die Steuerflucht und andere betrügerische Praktiken der Reichen groß. Wieso, fragt sich der Durchschnittsdeutsche, müssen die Reichen, deren Reichtum ständig wächst (die berühmte Schere zwischen Arm und Reich) auch noch den Fiskus betrügen? Sind das Charakterdefizite? Uli Hoeneß, der sympathische Fußballer und engagierte Bürger, so ein Raffzahn und Zocker? Der Postchef Zumdick vor einigen Jahren. Und tausend andere. Stimmt der Spruch: »Je mehr er hat, je mehr er will, nie stehen seine Wünsche still«?
Gegenwärtig ist die Empörung über die Steuerflucht und andere betrügerische Praktiken der Reichen groß. Wieso, fragt sich der Durchschnittsdeutsche, müssen die Reichen, deren Reichtum ständig wächst (die berühmte Schere zwischen Arm und Reich) auch noch den Fiskus betrügen? Sind das Charakterdefizite? Uli Hoeneß, der sympathische Fußballer und engagierte Bürger, so ein Raffzahn und Zocker? Der Postchef Zumdick vor einigen Jahren. Und tausend andere. Stimmt der Spruch: »Je mehr er hat, je mehr er will, nie stehen seine Wünsche still«?
Was könnte bloß das Motiv der Reichen sein, sich weiter zu bereichern, nichts zu verschenken? Darüber hat sich Heinrich Heine in seinen Berichten aus Paris im Jahr Gedanken gemacht. Am 5. Mai 1843 schildert Heine, anlässlich der Eröffnung der beiden Eisenbahnlinien nach Orleans, die Rolle großen Kapitalgesellschaften zur Finanzierung der Eisenbahnen. Und kommt dann auf das Bankhaus Rothschild zu sprechen. Auf dem Höhepunkt seines Einflusses sei der Baron von Rothschild, der reichste Mann seiner Zeit, wie Ludwig XIV. nur mit der Sonne zu vergleichen. Aber diese arme Sonne hat keine Ruhe vor ihren Anbetern, die ihm so stark zusetzen, dass man Mitleid mit ihm haben möchte. »Ich glaube überhaupt, das Geld ist für ihn mehr ein Unglück als ein Glück; er muss viel leiden von dem Andrang des vielen Elends, das er lindern soll.« »Überreichtum ist vielleicht schwerer zu ertragen als Armut.«
Jedem, der sich in großer Geldnot befindet, rät Heine, zu Herrn von Rothschild zu gehen, nicht um zu borgen, denn er zweifelt, dass er etwas Erkleckliches bekommt, sondern um sich durch den Anblick jenes Geldelends zu trösten. Und jetzt folgt: »Wie unglücklich sind doch die Reichen in diesem Leben- und nach diesem Tode kommen sie nicht einmal in den Himmel! ‚Ein Kamel wird eher durch ein Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher in das Himmelreich käme‘, dieses Wort des göttlichen Kommunisten ist ein furchtbares Anathema und zeugt von seinem bitteren Hass gegen die Börse und haute finance von Jerusalem. Es wimmelt in der Welt von Philanthropen, es gibt Tierquälergesellschaften, und man tut wirklich sehr viel für die Armen. Aber für die Reichen, die noch viel unglücklicher sind, geschieht gar nichts.
Statt Preisfragen über Seidenkultur, Stallfütterung und Kantsche Philosophie aufzugeben, sollten unsere gelehrten Sozietäten einen bedeutenden Preis aussetzen zur Lösung der Frage: Wie man ein Kamel durch ein Nadelöhr fädeln könne? Ehe diese große Kamelfrage gelöst ist und die Reichen eine Aussicht gewinnen ins Himmelreich zu kommen, wird auch für die Armen kein durchgreifendes Heil begründet. (…) Wüssten die Reichen, dass sie dort oben wieder in alle Ewigkeit mit uns zusammen hausen müssen, so würden sie sich gewiß hier auf Erden etwas genieren und sich hüten, uns gar zu sehr zu misshandeln. Laßt uns daher vor allem die große Kamelfrage lösen.«
Heine treibt seinen Spaß mit dem ehrwürdigen Text, über den in der Kirchen- und Weltgeschichte schon so viel gerätselt und gepredigt worden ist. Sein genialer Einfall besteht darin, sich auf die Seite der unglücklichen und gequälten Reichen zu schlagen, die vom Himmelreich ausgeschlossen sind. Geschickt hat er sich durch die Schilderung der bemitleidenswerten Lage des Barons Rotschild an das Thema Last des Reichtums herangearbeitet. Jesu Satz wird nicht relativiert oder spitzfindig ausgelegt. Etwa in der Art, es gab ein kleines Stadttor namens Nadelöhr in Jerusalem, durch das gerade so eben ein Kamel passte, eine reichtumsgünstige Auslegung, die seit dem Hochmittelalter bekannt ist und sich hartnäckig hält, obwohl es erwiesenermaßen nie ein solches Tor gegeben hat.
Überhaupt ist die Auslegungsgeschichte der Geschichte vom reichen Jüngling eine Fundgrube exegetischer Verbiegungen. Schon in den Evangelien selber wird das radikale »Verkaufe alles ‚was du hast und gib’s den Armen« erweicht. Das geschieht im Lukasevangelium in der Geschichte vom reichen Zöllner Zachäus, in dessen Haus Jesus einkehrt. Er tritt vor Jesus hin und sagt: »die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen und was ich unrecht erworben habe, erstatte ich vierfach.«
Diese Selbstanzeige eines Reichen ist wohl die erste pragmatische Lösung der großen Kamelfrage, die wir kennen. Kein spontaner Einfall, sondern sie wird in der Gemeinde, in der und für die Lukas schreibt, Praxis gewesen sein. Sie findet sich immerhin noch 250 Jahre später bei Basilius dem Großen. Von den vererbenden Familienvätern fordert dieser, dass sie mehr als die Hälfte ihres Vermögens der Seele, sprich Gott, vererben. Dieser »Seelteil“, nun zugunsten des Staates, wäre bei der Reform der Erbschaftssteuer doch ein guter Richtsatz. Danach aber setzt sich die Tendenz durch, das Gebot dahingehend zu mildern, nur etwas von dem Vermögen den Armen abzugeben.
Die katholische wie die protestantische Auslegungsgeschichte dieses Verses ist eine der Verdrängung. Wie klar doch dagegen Heine argumentiert, er weicht nicht den geldkritischen Ansatz Jesu nicht auf, er aktualisiert ihn, ablesbar an den Begriffen Bankiers, Hochfinanz, Börse. Vor Augen hat er das Aufkommen riesiger Finanzvermögen und ‑spekulationen, von den Eisenbahnaktien (die Heine selber kaufte) über Rothschild zu Jesu Verdikt – Geld regiert die Welt. In einem Artikel vom März 1841 schreibt Heine: »Das Geld ist der Gott unserer Zeit.«
Die Reichen haben es schwer, weil sie nicht ins Himmelreich kommen. Das also ist der Grund für das widersinnige Verhalten – auch heutzutage. Mag man auch nicht mehr an den Himmel glauben, selbst als Bayer nicht, untergründig wirkt der Satz nach. Da darf man doch an die Geschichte vom Zöllner Zachäus erinnern. Sie eröffnet für Uli Hoeneß und andere Steuersünder eine Perspektive – gib die Hälfte den Armen und erstatte vierfach, was du unrecht erworben. Dann öffnet sich für dich der Himmel auf Erden – du bist wieder angenommen, das treibt den armen Hoeneß besonders um und da hat er mein Mitgefühl, und darfst in der Talkshow, dem Himmel der medialen Präsenz, auftreten.
Aber das Problem des Überreichtums ist damit überhaupt nicht gelöst. Hoeneß, der Wurstfabrikant, ist ja verglichen mit den Superreichen fast ein »armes Würstchen«. Clans wie die Quandts in Deutschland konnten sich 2012 allein aufgrund ihres BMW-Pakets auf eine Dividende von 650 Millionen Euro freuen.
In gewisser Weise sind die Steueroasen, sagt der Soziologe H. J. Krysmanski (0,1% – Das Imperium der Milliardäre) Waffendepots im Krieg der Reichen, und er zitiert Warren Buffett, mit einem Privatvermögen von 60 Milliarden Dollar einer der reichsten Männer der Welt, mit folgenden Worten: »Es herrscht Klassenkrieg, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen.«
Was haben die Superreichen mit diesen Machtmitteln des Geldes, den 30 bis 50 Billionen Dollar, vor? Zunächst einmal wissen sie um die Wichtigkeit des Eindrucks , den sie in der Öffentlichkeit machen, und deswegen haben Bill Gates und W. Buffett im Jahr 2009 ein Dutzend der liberalsten US-amerikanischen Milliardäre eingeladen, um ganz wie der Zachäus des Evangelisten Lukas, sich zu verpflichten, die Hälfte ihres Vermögens für philanthropische Zwecke zu stiften.
Das sieht sozial gut aus, hat aber zur Konsequenz, dass sie damit halböffentliche Aufgaben übernehmen. Krysmanski hat den Superreichtum mit einer Ringburg verglichen, in deren Mitte die 0,01 % Superreiche sitzen, Milliardäre wie Warren Buffet und Bill Gates – »eine völlig losgelöste und zu allem fähige soziale Schicht, welcher die Wissens-und Informationsgesellschaft alle Mittel in die Hände legt, um sich als neue gesellschaftliche Mitte zu etablieren.“
Um sie herum und als zweiter Ring gruppieren sich die Konzern- und Finanzeliten als Spezialisten der Verwertung und Sicherung des Reichtums. Den nächsten Funktionsring bilden die politischen Eliten, also die nationalen Regierungen, die sicherstellen, dass der Reichtum von unten nach oben verteilt wird. Die größte Gruppe hält sich auf dem Außenring der Festung auf – die Funktions- und Wissenseliten aller Art, von Wissenschaftlern über die Techno-und Bürokraten bis zu den Unterhaltungseliten in Medien, Kultur und Sport.
Während sich also die Reichen verschanzen und gleichzeitig ihren Einfluss auf Politik und Wirtschaft auszuweiten versuchen, häuft sich um die Ringburg das Konfliktpotential – nach einer Studie des britischen Verteidigungsministeriums werden im Jahr 2037 60 % der Menschen weltweit in verslumten Städten um die Bankentürme sich zusammendrängen. Diese Konzentration von Not, Arbeitslosigkeit und Unzufriedenheit wird einen gewaltigen Sprengsatz darstellen.
Einige Analytiker nehmen an, dass die Geldeliten sich weiter verselbständigen wollen. Sie beginnen, auf eigene Faust mit Söldner-Armeen sowie privaten Polizei-und Geheimdiensten zu kooperieren. So soll der russisch-britische Milliardär Abramowitsch auf seiner 475 Mill. teuren Megayacht Eclipse ein Raketenabwehrsystem installiert haben.
Ist das jetzt eine neue Verschwörungstheorie? Nicht unbedingt: In der Tat ist die Heinesche Kamelfrage ungelöst – privaten Superreichtum demokratisch zu kontrollieren, ist vor allem eine Frage des Datenwissens. Und genau das ist das Nadelöhr, durch das man die Superreichen fädeln müsste. Schon bei den Steuer-CDs, die bundesdeutsche Länder kauften, um die vielen reichen Steuersünder mittlerer Größe zu überführen, ist das erkennbar. Aber trauen sich die Regierungen auch an die Superreichen heran? Eher nicht, aber ohne ihre demokratische Kontrolle wird es nicht wirklich besser werden, und so wird uns die Kamelfrage wohl noch lange begleiten.
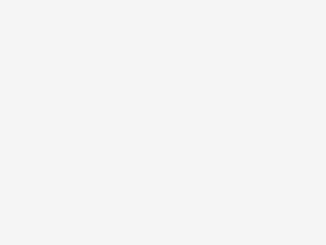
Wir vergessen meist, dass Eigentum Verhandlungssache ist. Der Satz „Das gehört mir“ kann jederzeit infrage gestellt werden durch ein „Sagt wer?“ oder „Wieso?“. In Krisen nehmen die Herausforderungen an das Eigentum zu. Es ist höchste Zeit, dass wir massives Vermögen grundsätzlich infrage stellen. Es gefährdet das Gemeinwohl und ist durch nichts zu rechtfertigen. Wer das Thema umgeht, ist der Vermögensverteidigungsindustrie anheimgefallen, die neben der Geldwäsche auch die Gehirnwäsche beherrscht.
Wer es so benennt, verkennt, dass der Staat das Recht hat, Steuern einzuziehen und umzuverteilen. Damit wird deutlich, dass individuelles Einkommen nie nur durch eigene Leistung zustande kommt, sondern durch viele Vorleistungen von anderen.
Was haben die Superreichen mit diesen Machtmitteln des Geldes, den 30 bis 50 Billionen Dollar, vor? Zunächst einmal wissen sie um die Wichtigkeit des Eindrucks , den sie in der Öffentlichkeit machen, und deswegen haben Bill Gates und W. Buffett im Jahr 2009 ein Dutzend der liberalsten US-amerikanischen Milliardäre eingeladen, um ganz wie der Zachäus des Evangelisten Lukas, sich zu verpflichten, die Hälfte ihres Vermögens für philanthropische Zwecke zu stiften.