

Gestern Nacht in der Nähe von Fehrbellin, ein wunderbarer Sternenhimmel im Dezember, eine hell leuchtende Venus, kleiner und großer Wagen, Polarstern, der Orion, Pegasus usw. ich schaue und kann mich nicht sattsehen an den Himmelswundern.
Am Nachmittag war ich in Neuruppin, dem Geburtsort Theodor Fontanes, stand vor der Löwenapotheke, in der er zur Welt kam. Die Szene in Effi Briest fällt mir ein, als die nach dem Scheitern ihrer Ehe ins Elternhaus zurückgekehrte Effi im Spätsommer am Fenster sitzt, dem Sternschnuppenfall zuschaut und naiv-herzergreifend sinniert: »Ich war immer eine schwache Christin, aber ob wir nicht vielleicht von dort oben stammen, und wenn es vorbei ist, in unsere himmlische Heimat zurückkehren. Ich weiß es nicht, ich habe nur die Sehnsucht …«
Und dann der Kommentar des Autors, der hier aus seiner Rolle fällt: »Arme Effi, du hast zulange zu den Himmelswundern hinaufgesehen und das Ende war, dass Nachtluft und Nebel von den Teichen sie wieder aufs Krankenlager warfen.« Sie stirbt kurz darauf, eine schuldbewusste Sternseherin und Ehebrecherin, die so ihren Selbstmord inszeniert. Die Heldin des heutigen Films, dachte ich, könnte eine Urenkelin von Effi sein. Sie ist dort, wo die leidende Effi sich hinträumte – im Weltall, der Heimat vor den Sternen, 600 km von der Erde entfernt.
Insgesamt 4 Jahre hat der mexikanische Regisseur Alfonso Cuaron (Der Gefangene von Askaban) an seinem Weltraumepos gebastelt. Er musste diverse Rückschläge überstehen, bis er seine Vision ohne Einschränkungen verwirklichen konnte. Man kann sagen: Die Mühe hat sich gelohnt – ein außerordentlicher Film über eine Mission im All ist entstanden, der sich von dem Apollo 13-Nationalismus wohltuend unterscheidet und in manchen Sequenzen an Kubricks Odyssee im Weltraum heranreicht.
Ein Magischer Moment zu Beginn, wenn ein Insert sagt: »Leben im Weltraum ist unmöglich«, und es still ist im Kino, ganz still, bis Stimmen-und Musikfetzen leise einsetzen. Es sind Geräusche, die die US-Astronauten in ihren Helmen hören. Und schließlich sieht man sie in ihren Weltraumanzügen, in 3D schweben sie auf uns zu. Und dann sieht man die Bilder des Erdballs, faszinierende Aufnahmen, die immer wieder die umgekehrte Sehnsucht nach dem Blauen Planeten zeigen.
Die Story: Das 5‑köpfige Astronautenteam des Raumschiffs Explorer befindet sich auf einer Routinemission. Am Weltraumteleskop soll die Medizinerin Dr. Ryan Stone (Sandra Bullock) einen Scanner installieren. Sie ist aufgeregt, abgebrüht kreist ihr die Mission überwachender Kollege Matt Kowalski (George Clooney) um sie herum, ein alter Weltraumhase auf seinem letzten Flug; die beiden kommen ins Gespräch, erzählen sich ganz kurz ihre Lebensgeschichten, die Katastrophen auf der Erde, Unfalltod der Tochter, Verlassenwerden von der Ehefrau.
Und dann die Katastrophe im All – Weltraumschrott von einer Kollision einer russischen Station mit einem Kometen rast auf die Station zu, durchsiebt sie, der Kontakt zu Houston reisst ab, sie sind auf sich allein gestellt, wollen sich in eine andere russische Weltraumstation retten, der Schub reicht nur noch für einen, Kowalski gibt der Frau eine letzte Hilfestellung, um dann im All zu verschwinden.
Der Held, der sich opfert. Von da an ist Dr. Ryan auf sich allein gestellt. Zwischen Resignation und Überlebenswillen siegt der Letztere, und sie schafft das fast Unmögliche – wieder auf der Erde zu landen. Eine schwer atmende erschöpfte Frau liegt auf Mutter Erde mit ihrer Schwerkraft. Ein happy ending einer Weltraumreise.
Vor allem ein Film über Schwerkraft und Schwerelosigkeit. Es gibt sie in der Kunst, Mariä Himmelfahrt auf den Decken barocker Kirchen, wunderbar, wie dort alles nach oben in den Himmel schwebt zu Gottvater und dem Herrn Jesus. Alle Erdenschwere ledig segeln sie davon – die heiligen Gestalten. Oder in einer Melodie Mozarts, die sich aufschwingt wie selige Amoretten, wie etwa in der Violinsonate A‑Dur KV 504.
Oder in einem gelungenen Gedicht Rilkes seine schwerelose Sprachmelodie. Schließlich im Ballett, wo für einen Moment die Schwerkraft aufgehoben scheint, wenn diese Künstler einzeln oder zu mehreren durch die Luft segeln.
Der Mensch möchte Schwerkraft aufheben. Es gelingt ihm, wenn die Zentrifugalbeschleunigung genau der Schwerebeschleunigung entspricht oder eben im All. Aber es ist kein Ort zum Leben. Heimat bleibt die Erde mit all ihren Problemen, mit Vergänglichkeit und Tod und den wenigen kostbaren Jahren des Lebens.
Eines ist unsere Sehnsucht nach den Sternen, ein anderes das Kosmonautenleben im All. Seit wir Kinder waren, seit Peterchens Mondfahrt ist es ein Traum, sich frei im All zu bewegen, zu schweben. Da suchen sie das Beinchen des Maikäfers, die Kinder. Und da sind wir und schauen Dr. Ryan, wie sie heftig atmend versucht, den Scanner zu reparieren.
Die ungeheure Weite des Alls erschrickt, wie klein und verloren sind die Astronauten dort und wir mit ihnen. Die Abhängigkeit von der Stimme aus Houston (gesprochen von Ed Harris), das Alleinsein, als sie ausbleibt, die Selbstgespräche, die Verzweiflung.
Die quasireligiöse Kernszene: Dr. Ryan ist in der russischen Raumstation, kurzer Schwenk auf eine Ikone mit dem heiligen Christophorus, aber sie weiß nicht weiter, Feuer bricht aus, das Triebwerk zündet nicht: Wenn ich könnte, würde ich jetzt beten, sagt sie, aber niemand hat mich gelehrt zu beten. Wir müssen sterben, ja das weiß ich, aber normalerweise weiß man nicht wann, nur ich weiß, dass es jetzt gleich passieren wird. Sie schließt die Augen und ergibt sich in ihr Schicksal.
Da öffnet sich die Schleuse und Matt Kowalski stemmt sich hinein, nimmt seinen Helm ab (wenigstens einmal für seine weiblichen Fans), angelt sich den vom Kommandanten versteckten Wodka, nimmt einen Schluck und gibt ruhig seine Instruktionen. Mit dem Bremsschub starten, das sei die Lösung, du schaffst es.
Eine rettende Halluzination, Dr. Ryan startet, kann sich von dem Bremsfallschirm der Station befreien, düst zur chinesischen Station – dort hängt ein Buddhabild – katapultiert sich dort hinein, durchbricht mit der Feuer fangenden Landekapsel die Erdatmosphäre und landet in einem Bergsee, die Stimme von Houston meldet sich wieder.
Eine Abenteuergeschichte im All, ziemlich wirklichkeitsgetreu erzählt, auch wenn es einige Kritikpunkte gibt – so hatte die rettende chinesische Station eine ganz andere Umlaufbahn. Bullock wechselt zwei mal die Schutzkleidung, wir sehen ihren schlanken Körper in diesem unerotischen Film, eine Astronautin hätte Windeln angehabt, aber das wird natürlich nicht gezeigt. Die 3D-Filmtechnik schafft es, dass die Simulation sich uns extrem subjektiv unmittelbar über Augen und Ohren mitteilt.
Wie in der Achterbahn sausen wir als Zuschauer mit durchs All, möchten vor Angstlust kreischen und haben immer wieder die wunderschöne Erde im Blick. Der Film heißt Gravity, Schwerkraft – der Überlebenswille der Astronautin ist gekoppelt an diese Erfahrung der Schwerkraft, zurück zur Erde, von der wir stammen.
Brüder, Schwestern, bleibt der Erde treu, möchte man mit Nietzsches Zarathustra rufen, doch dann hätten wir nicht dieses aufregende Weltraumabenteuer. Zum Schluss ist man fast so erschlagen wie die Heldin, japst im Kino-Sessel nach Luft.
Und freut sich auf den Sternenhimmel, der doch in der Stadt kaum zu sehen ist. Vielleicht der Abendstern, die Venus.

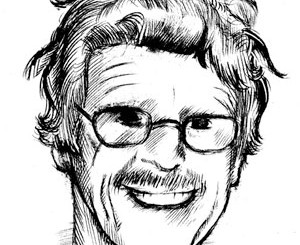
Hinterlasse jetzt einen Kommentar