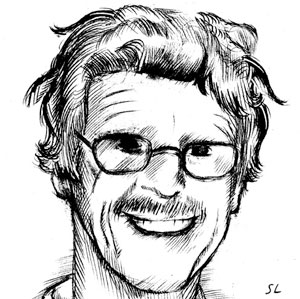

Religion und soziale Fragen sind als gruselndes Dekor in Talkshows präsent, ansonsten aber aus dem täglichen Diskurs gewichen. »Hauptsache nicht wir« und »der Papst ist von Gestern, mit all den pädophilen Priestern und den Kondomen« – das ist medialer Tenor, und das natürlich mit Recht, schließlich geht es um den Erhalt der bürgerlichen Werte und das tägliche Einkaufserlebnis. Das wollen wir nicht so stehen lassen.
Deswegen bekommt das HAMBURGER FEUILLETON Zuwachs: In loser Folge wird der Sozialtheologe Hans-Jürgen Benedict an dieser Stelle unter dem Titel »Bene.Diktum« seine Reflektionen zu Gesellschaftsthemen veröffentlichen. Benedict, geboren 1941 in Hamburg, ist einer der engagiertesten Beobachter sozialer Themen in der evangelischen Kirche. Er war bis 2006 Professor an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie in Hamburg und publiziert inzwischen zu Themen zwischen Glauben, Sozialem und Literatur. Wir freuen uns, ihn als Autor gewonnen zu haben.
Hier also unsere neue Religions- und Gesellschaftskolumne »Bene.Diktum«:
Im Hamburger Institut für Sozialforschung stellte die Soziologin Natalie Grimm in einem interessanten Vortrag erste Ergebnisse einer Langzeit-Untersuchung zum sogenannten Prekariat vor. Die Studie ist Teil des Kooperationsprojektes »Gesellschaftliche Teilhabe im Spannungsfeld von Langzeitarbeitslosigkeit, Erwerbsintegration und öffentlich geförderter Beschäftigung« und wird vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) drittmittelfinanziert und geleitet.
In dieser Untersuchung wurde über einen Zeitraum von fast 5 Jahren die Untersuchungsgruppe von 152 Teilnehmern immer wieder nach ihrem Schicksal auf dem Arbeitsmarkt befragt. Wie ist es ihnen ergangen zwischen 2001 und 2011? »Prekariat im Dauerzustand. Erwerbsbiographien in der Zwischenzone der Arbeitswelt«, so der Titel des Vortrags.
Die Ergebnisse dieser empirischen Untersuchung sind alarmierend. Es war zwar bekannt, dass die Deregulierungen auf dem Arbeitsmarkt infolge Hartz I und II also, Leiharbeit, Zeitarbeit, Minijobs und Aufstockerjobs in dieser Zeit dramatisch zugenommen haben. Aber immer war damit noch die Hoffnung verbunden, dass es sich um vorübergehende Phasen einer Erwerbsbiographie handelt und die davon Betroffenen wieder in feste Arbeitsverhältnisse gelangen. Dem ist aber nicht so.
Nach der Implementierung der Hartz IV-Gesetze 2005 hat sich eine Zwischenzone der Prekarität gebildet und stabilisiert, aus der die Menschen, die in diese Zone geraten, nur schwer wieder herauskommen. Ungewissheit wird zur entscheidenden Existenzerfahrung der Befragten. Die Beschäftigungsphasen erscheinen als Ruhepausen einer instabilen Erwerbsbiographie, oder wie ein Befragter es ausdrückte: »Jetzt kann ich mich ein bißchen beruhigen.« War früher die Arbeitspause ein ersehntes Ziel, so ist die unsichere Arbeit jetzt eine kurze Ruhepause, die auf die nächste Arbeitslosigkeit und den Hilfebezug vorbereitet – eine zynische Umkehrung. Man ist zwar auf dem Arbeitsmarkt, aber man gehört nicht mehr fest dazu.
Die prekär Beschäftigten haben es schwer, sich sozialstrukturell einzuordnen. Gefragt zu wem sie gehören, ist »untere Mittelschicht« die eher zögerliche Antwort. Gleichzeitig grenzt man sich gegen die mittel- und langfristig Arbeitslosen ab. Zu denen will man nicht gehören. Mit der Prekarität ist die Qualität und Stabilität gesellschaftlicher Teilhabe deutlich gesunken, die kulturellen Möglichkeiten sind eingeschränkt. Das Leben wird wieder zu einem Überlebenskampf auf höherem Niveau. Der prekär beschäftigte ist der Zusage, fast möchte ich sagen der Gnade, dem Geschenk eines festen Arbeitsplatzes nicht mehr gewärtig. Er bleibt im Zustand der Ungewißheit und des ständigen Kampfes um Jobs und Arbeitsgelegenheiten. Selbst die Ein-Euro-Jobs sind jetzt von Kürzungen bedroht.
Zu den gravierenden Folgen dieser Entwicklung gehört auch die Erscheinung, die Robert Castel »negative Individualisierung« genannt hat: die Konzentration auf sich selbst überlagert den Blick auf die anderen. So wie man von der Gesellschaft nur begrenzte Solidarität erfährt,in Gestalt geringerer Entlohnung, magerer Transferleistungen und notdürftige Aufstockung, so zwingt der Überlebenskampf auf dem Arbeitsmarkt zur Abgrenzung und Innenschau. Die ständige Unsicherheit, wie lange dauert mein Leiharbeitsverhältnis, wann bekomme ich endlich einen festen Arbeitsplatz, wie komme ich aus dem Hilfebezug heraus, zermürbt.
Man könnte sagen – diese neue Gruppe der unsicheren Erwerbstätigen ist der Preis für die Senkung der Arbeitslosenziffern, die Politik und Wirtschaft für ihre öffentliche Legitimation so nötig brauchen. Der aktivierende Staat will Erfolge vorzeigen, und die erringt er auf dem Rücken einer Teils der Erwerbspopulation. Nicht Politik und Wirtschaft sind bereit einen Preis dafür zu zahlen, sondern sie zwingen einem Teil der Erwerbstätigen dieses Schicksal auf.
Sie müssen das Opfer für die Gesamtgesellschaft erbringen, das den Politikern die Verringerung der Arbeitslosenzahlen und der Mehrheit der Erwerbsbevölkerung einigermaßen sichere Arbeitsplätze bringt. Nach einer Zeit der Vollbeschäftigung und nach einer Phase sehr hoher Massenarbeitslosigkeit jetzt also eine angeblich erträgliche Massenarbeitslosigkeit. Man könnte auch sagen: die nach wie vor bestehende Massenarbeitslosigkeit wird ein wenig geschönt durch prekäre Beschäftigung als Dauerzustand.
Mich als Theologen erinnert diese fundamentale Verunsicherung der Erwerbsbiographie an die Heilsungewißheit der frühen Neuzeit. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Frage, die Luther umtrieb und für die er mit der Rechtfertigung aus Gnade allein eine Lösung fand , wollte der Genfer Reformator Calvin anders als Luther nicht endgültig beantworten. Heilsunsicherheit blieb aufgrund der Ungewissheit der Erwählung erhalten, das war die Lehre von der Prädestination, einer Erwählung also, der sich der Gläubige nie endgültig sicher sein konnte.
Max Weber hat in seinem berühmten Text »Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« dargelegt, dass der kapitalistische Geist durch diese protestantische innerweltliche Askese angetrieben und zu rastlosem Gewinnstreben motiviert wurde. Nach der Verflüchtigung des Antriebsgeistes bleibt einerseits zurück das »stahlharte Gehäuse« des modernen Arbeitslebens, andererseits die hybride Entwicklung zum Finanzkapitalismus. Die fundamentale Verunsicherung auf dem Arbeitsmarkt aber hält Millionen von Erwerbstätigen in ihren Fängen, zermürbt sie, macht sie oft krank und depressiv.
Sie können nicht mehr ruhig sein, ohne Angst leben, sich auf etwas bedingungslos verlassen. Sie müssen Zumutungen hinnehmen, sich mühen, kämpfen, Schicksalsschläge ertragen, ohne noch die seelischen Ressourcen dafür zu haben. Früher konnten eine bestimmte Schichtzugehörigkeit, die Klassenlage oder die kollektiv-soziale Einbindung in Gesellungen religiöser oder sozialer Art das teilweise kompensieren. Heute ist jeder auf sich allein gestellt. Insofern findet das momentan vieldiskutierte Burnout in dieser neuen Prekariatsschicht ständig statt.
Wie sagt Hölderlin im Schicksalslied:
»Doch uns ist gegeben
auf keiner Stätte zu ruhn
es schwinden, es fallen
die leidenden Menschen
Blindlings von einer Stunde zur andern
wie Wasser von Klippe
zu Klippe geworfen
jahrlang ins Ungewisse hinab.«
Das ist das Schicksal der prekär Beschäftigten. Das sind die kleinen Passionsgeschichten der postindustriellen Moderne. Einer Kirche, die von der Rechtfertigung des sündigen Menschen redet, kann dieser Zustand nicht gleichgültig sein. Die theologische Kategorie der Rechtfertigung müsste heute sozialphilosophisch als Anerkennung neu ausgelegt werden. Wo das Menschenrecht auf Anerkennung im Marktgeschehen verletzt wird, muss man von einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung sprechen. Der Markt verspricht etwas, was er nicht halten kann oder will. Wie ist Anerkennung heute im Arbeitsleben sozial umzusetzen? Mindestlöhne, Eingrenzung des Leiharbeitssektors und der Zeitarbeit, besser entlohnte Arbeitsplätze statt Aufstockung, Aufbau eines zweiten Arbeitsmarktes wären erste Schritte, um der Prekarität als Dauerzustand bzw. der fundamentalen Heilsungewißheit auf dem Arbeitsmarkt wenigstens anfangsweise zu begegnen.
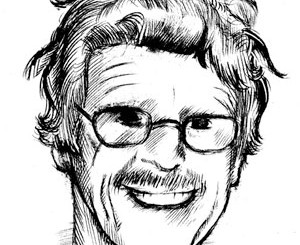
Hinterlasse jetzt einen Kommentar