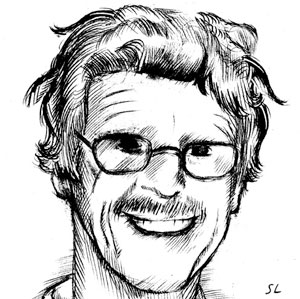
 Was fangen wir mit der Rede vom Himmel an? Seit der Entmythologisierung durch den streitbaren Dialektiker Rudolf Bultmann mit ihrer Erledigung des Dreistockwerk-Weltbilds ist jedem Theologen eigentlich klar, dass die Rede vom Himmel als Ort obsolet ist. Der Himmel ist kein Ort, sondern ein Zustand – weswegen das Englische auch zwischen sky und heaven unterscheidet.
Was fangen wir mit der Rede vom Himmel an? Seit der Entmythologisierung durch den streitbaren Dialektiker Rudolf Bultmann mit ihrer Erledigung des Dreistockwerk-Weltbilds ist jedem Theologen eigentlich klar, dass die Rede vom Himmel als Ort obsolet ist. Der Himmel ist kein Ort, sondern ein Zustand – weswegen das Englische auch zwischen sky und heaven unterscheidet.
Den Himmel als Ort der Seligen genießen wir allenfalls noch in der Betrachtung von Kunstwerken, die diesen Himmel mit der auf Wolken schwebenden Madonna bei ihrer Himmelfahrt traumhaft schön in barocken Kirchen malen oder ihn musikalisch evozieren, wie im Paradisi gloria von Rossinis Stabat mater oder schreckhaft dramatisch in Verdis Dies irae.
Im Übrigen wird der Himmel zum Refugium des Witzes – »Kommt ein Pfarrer in den Himmel …« –, des Kitsches in Operetten und Schlagern – »Ich tanze mit dir in den Himmel hinein« – oder des Interesses an Gottes Bodenpersonal in Fernsehserien: »Um Himmels willen«.
Der Giessener Soziologe und Theologe Reimer Gronemeyer hat nun ein schönes Buch über den Himmel geschrieben: [Himmel, der].
Es heißt im Untertitel Sehnsucht nach einem verlorenen Ort. Es ist eine Streitschrift, die an den schönen Himmelsglauben früherer Zeiten und Generationen erinnert – einen Glauben, der den Himmel als Ort des Sinns sah, als Ort der Weltdeutung durch die Mythen von der Erschaffung von Himmel und Erde, als Ort der Hoffnung in den Endzeitvisionen vom himmlischen Jerusalem und Jüngsten Gericht und als Ort Gottes, der dem Menschen Grenzen setzt.
Dieser Ort ist weitgehend verloren gegangen. Der Himmel, schreibt Gronemeyer, »scheint nur noch ein Arbeitsfeld für Astrophysiker, Rohstoffexperten, Prospekteure mit Goldgräbermentalität und für Extrem-Touristen zu sein.« Gronemeyer stellt den alten Himmel diesem neuen Himmel in kritischer, rettender Absicht gegenüber. Es ist kein Rückfall hinter die kopernikanische Wende, die er ausführlich schildert, keine unkritische romantische Wiederverzauberung, sondern eher mit Matthias Claudius Sternseherin Lise die Erinnerung an eine Sehnsucht, die Maßstäbe zu setzen wußte: »Es gibt was Besseres in der Welt als all ihr Schmerz und Lust«.
Gronemeyer sieht in dem heutigen Umgang der Astrophysik mit dem Weltraum (man denke an die gerade geglückte Mars-Erkundung) das gleiche technisch-kalte Prinzip am Werk, das die Globalisierung im Dienste des Kapitals bestimmt. In dem der Mensch den Himmel abschafft und sich zum Herrn der Welten und der Erkenntnis aufschwingt, klagt Gronemeyer, geht alle Maßstäblichkeit verloren.
Den kalten analytischen Ton von Astrophysikern wie Stephen Hawking und Hirnwissenschaftlern, die die Existenz einer Seele bestreiten, kritisiert er deswegen heftig. Vielleicht etwas zu heftig. Denn die Einsicht, dass wir nicht mehr unter einer Himmelskuppel geborgen, sondern explodierende Partikel im explodierenden Universum sind, ist ja nicht zurückzunehmen. Auch nicht das Doppelgefühl von Beseligung und Vernichtung, das Adalbert Stifter angesichts der Beschreibung des ungeheuren Universums ergriff.
Gronemeyer zitiert den alten Himmel der Mythologen, Theologen und Poeten, um der Menschheit einen Maßstab zurückzugeben. (Nebenbei bemerkt kritisiert er zu Unrecht Heines Satz „Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen“, denn Heine wollte nicht wie Marx den Himmel ersatzweise in die Zukunft der klassenlosen Gesellschaft verlegen, noch wollte Freud das, der diesen Satz Heines zustimmend zitierte.)
Das tut er mit Fragen und Appellen ebenso wie mit geglückten Skizzen des Verlusts, so im Kapitel über die Engel als Kommunikatoren in einer Welt elektronischer Selbstvergottung und der Nennung nachahmenswerter Beispiele der Gegenwehr gegen Umweltzerstörung und Raubbau an dem blauen Planeten mit seinem »Recht auf Sternenlicht«.
Meine Frage an dieses glänzend geschriebene, angenehm belehrende und engagierte Buch über den Himmel ist eher, ob die Weckung der Sehnsucht nach dem verlorenen Ort Himmel die Probleme lösen kann, die es benennt.
Ich erinnere an die berühmte Kantsche Formel aus der Kritik der praktischen Vernunft, die Gronemeyer erstaunlicherweise nicht ein einziges Mal nennt – »Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.«
Beide bestimmen mein Handeln. Zeigt mir das eine meine Nichtigkeit im Weltall, gibt mir das andere einen Halt in meiner Individualität in dieser Welt. Und auch Regeln für mein Verhalten zu Mitmenschen und Mitwelt. Daran hapert es, wie Gronemeyer zeigt.
Vor allem bei denjenigen, die Politik, Wirtschaft und Wissenschaft bestimmen. Besonders die Ambivalenz von Wissenschaft als Leben erleichternder Fortschritt und das Leben auf dem Planeten gefährdender Eingriff ist hier zu nennen. Die Erinnerung an den Himmel hilft hier weniger als eine Ethik der Verantwortung im Sinne von Hans Jonas. Nötig sind internationale Kontrollinstrumente ebenso wie persönliche Verhaltensänderungen. Im Übrigen:
»Halt an, wo laufst du hin, der Himmel ist in dir/suchstu Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.« (Angelus Silesius) [space size=15]
Reimer Groenemeyer:
Der Himmel: Sehnsucht nach einem verlorenen Ort
[Amazon Partnerlink]
Hinterlasse jetzt einen Kommentar