Nur eine der kleinen Birnen am Bühnenrand spielt nicht so recht mit. Es ist die neunte von links, die sich hin und wieder der Lichtchoreographie in der Laeisz-Halle verweigert. Unter der Decke des ehrwürdigen Hauses hängt ein Gitterahmen, der zusätzliche Beleuchtung trägt, 10 riesige Scheinwerferreflektoren sind auf das Publikum gerichtet, die in allen Farben schimmern. Die Lichterreihe an der Rampe erinnert an alte Kinoschilder, an die goldenen Zeiten Hollywoods, so, wie es einmal war. Die große Shownummer wird so angekündigt, es kann keinen Zweifel geben, dass dieser Abend auf Unterhaltung ausgerichtet ist. Till Brönner, trotz des Genöles mancher Kritiker der Deutschen liebster Jazzmusiker, ist in der Stadt.
Der Trompeter hat ein neues Album veröffentlich, dass es zu promoten gilt. So läuft das im Musikgeschäft, erst die Platte, dann die Tournee. Das neue Album heißt »The Good Life« und ist relativ konservativ und reduziert in seinen Arrangements, aber eine konzentrierte Arbeit mit großen Studiomusikern. Natürlich sind in den dazu bereits veröffentlichten Besprechungen die üblichen Till-Brönner-Klischees ausgepackt worden. Die Rede ist, wie fast immer, vom eigentlich brillanten Musiker, der aber unter seinen Möglichkeiten bleibe, weil er nicht authentisch genug sei, nicht gebrochen und doch allzu sehr dem weichen, schönen Klang huldige. Denn Jazz hat schmutzig zu sein und klebrig, wie zu heiß gewordenes Bitumen auf einer sommerlichen Landstraße, und am besten ist der Musiker arm wie eine Kirchenmaus und vor allem ein Geheimtip, der nur eingeweihten Connaisseuren bekannt zu sein hat. Nur dann ist es richtig, denn alles andere ist etwas für Leute, die in solche Konzerte gehen.
Was man aber alles getrost vergessen kann, vor allem an diesem Abend. Denn der Trompeter ist ein durch und durch eigenständiger Künstler, der sich zum Glück wenig um solche Etiketten schert und offenbar die Musik macht, die ihm gefällt, allen Forderungen der ernstnehmenden Gemeinde zum Trotz. Von denen sieht man an diesem Novemberabend in der Halle auch nicht viele, das Publikum ist arrivierter, besser gekleidet, durch und durch bürgerlich in Gestus und Gestalt, von den ernst dreinschauenden Schnauzbärten und Lederwesten, die sonst die Szene prägen, sieht man hier nicht viel.
Till Brönner hat sich eine Band zusammengestellt, die er als »ziemlich beste Freunde« vorstellt. Auch das ist ein Kinozitat, vielleicht nicht die gelungenste Pointe, aber sie drückt genau die Art von Harmonie aus, die sich ein Musiker wünschen mag. Diese Freunde sind Brönners alter Weggefährte, der Bassist Christian von Kaphengst, Gitarrist Bruno Müller, der Keyboarder Jo Barnikel, Schlagzeuger David »Fingers« Haynes, und der holländische Pianist Jasper Soffers. Dass der noch ein Fender Rhodes dabeihat, ist für den Abend genauso entscheidend wie der zweite Bläser auf der Bühne, der schwedische Saxofonist Magnus Lindgren. Es sind allesamt exzellente Musiker, das ist keine Frage.
Denn, nach all den smoothen Bakerismen, die den Mann berühmt und so beliebt gemacht haben, packen die Sieben auf der Bühne etwas überraschend das schwerere Besteck der 80er aus. Der Sound ist ausgesprochen druckvoll, man meint sich zurückversetzt in die glorreichen Zeiten der Fusion-Küchen im Jazz, all jener Gruppen, die nach Joe Zawinuls legendären »Weather Report« kamen. Die Brecker Brothers fallen einem da spontan ein, in ihrer energetischen Kombination von Trompete und Tenor, eine wenig Dave Grusin – oder gar der späte Miles Davis, der ja in seinen letzten Jahren, immer wieder nach neuen Sounds suchend, auch vor elektronischen Modifikationen seines berühmten Tones nicht zurückschreckte.
Und in der Tat meint man ihn, den Altmeister, in Brönners Spitzentönen, vor allem mit der »gestopften« Trompete, immer wieder durchzuhören: Ganz ähnliche Phrasen und verwandte Intonationen spielt Till Brönner da, ohne sich jedoch zum bedingungslosen Exegeten zu machen. Man hört von der Band viel Wah-Wah-Effekte, das Rhodes legt seinen raunend-analogen Sound als Basis unter die Melodiebögen der Solisten. Immer wieder im Zentrum steht der Dialog mit Magnus Carlsen, die beiden haben hörbaren Spaß am Duettieren, an der gegenseitigen Herausforderung – ein Ton gibt den anderen, eine Line fordert die nächste.
Auch wenn die Band wirklich stark besetzt ist, der Chef im Ring ist und bleibt Till Brönner. Seine Intonation und sein Ideenreichtum haben ihm tatsächlich Weltruhm eingebracht, die Exaktheit und Brillanz in seinem Spiel ist auch an diesem Abend überdeutlich. Es ist kein diffuser Klang, der aus Flügelhorn und Trompete strömt, auch in den lyrischen Phasen ist seine Strahlkraft und Genauigkeit zu hören. Und der Groove ist da, auch er unüberhörbar. Natürlich wird charmant moderiert, da hat er dazu gelernt, in früheren Zeiten ging das flott-saloppe mitunter am Publikum vorbei, heute sitzen die Pointen besser. Als er gegen Schluss über seinen Auftritt im Weißen Haus mit all den Musikergrößen spricht, die er so verehrt, ist er sichtlich beeindruckt, das nimmt man ihm ab. Man muss die Art der Bühnenpräsentation nicht mögen, aber der eingangs beschriebene Wille zum Entertainment ist beispiellos, darin ist Till Brönner ein wahrer kultureller Transatlantiker, stilistische Enge oder gar provinzielle Attitüde ist seine Sache nicht. Dieser Abend ist Unterhaltung auf sehr hohem Niveau, mit dem Mut zur großen Geste und mit wirklich ausgezeichneter Musik.
Als die Sache eigentlich schon beendet ist, nach Zugabe und Bachs Air, und man dann an ein wenig Gerührtheit schlucken müsste, da dreht die Band noch einmal an den Reglern und bläst die Hamburger Gesellschaft mit Pharell Williams »Happy« derart brachial aus dem Saal, dass es tatsächlich eine Freude ist. Man könnte dieses »Happy« auch für eine Art anarchischer Freude halten. Da ist er nämlich, der Jazz.
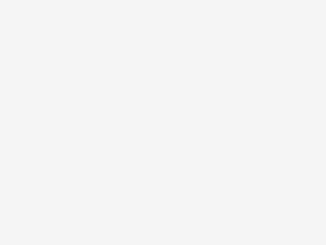


Hinterlasse jetzt einen Kommentar