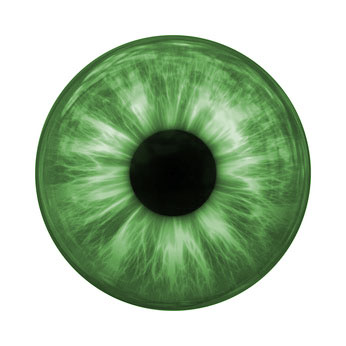
Dieses Buch gehört durchaus zu den bemerkenswerteren Erfahrungen, die ein zeitgenössischer Leser haben kann. Der raunende Ton, die spitzen Sentenzen, der Kosmos der Denker, in dem es sich bewegt, all das ist höchst unmodern, auf gar keinen Fall ist es modisch. Henning Ritter, um den es hier geht, FAZ-Redakteur, Ressortleiter jener Rubrik »Geisteswissenschaften«, die einst den vergangenen Ruhm dieses Blattes stützte und aufgebaut hatte, ist ein Autor, den man getrost als einen gelehrten Leser bezeichnen kann.
Er ist jemand, der genau und noch genauer schaut und seine Gedanken dazu notiert, Notiz-Hefte eben. Seine Themen und seine Lektüre sind ebenso unmodern wie die Attitude; schon auf den ersten Seiten fallen Namen wie Spengler, Schmitt und Sieburg, diese sind vor allem auch Namen einer verlorenen Epoche deutschen Intellektualismus. Es ist ein Rückblick in eine Zeit intensiver Auseinandersetzung mit Menschen und Geschichte, mit Inhalten, die noch nicht »Content« hießen, ein Blick auf einen unpopulären, einen verlustig gegangenen Diskurs.
Schon hört man die Stimmen, die dieses Werk altmodisch, gestrig nennen mögen, die jene Entscheidung für die Leipziger Auszeichnung in der Kategorie »Sachbuch« gar als unpolitisch und anachronistisch schmähen. Das ist Unrecht, denn das Buch ist seiner Zeit in dem Maße voraus, wie es rückwärtsgewandt erscheint. Und dafür gibt es vor allem einen guten Grund.
Dieser kleine, hübsch und unaufdringlich ausgestattete Leinenband mit seinen beiden gedeckten Lesebändchen und dem blassblaugrauen Schutzumschlag wird – und das ist überhaupt nicht vermessen zu behaupten – zu jenen Büchern gehören, die auch in näherer Zukunft aus dem Bücherregal genommen werden und nicht nur dort stehen bleiben, zum intellektuellen Dekor seiner Besitzer.
Vorausgesetzt, dieser Leser ist bereit, sich dem Autor zu stellen, nicht einmal, nicht zweimal, sondern immer wieder. Und das ist schon eine Aufgabe. Mitunter ehrfurchtgebietend kommt Henning Ritters Belesenheit daher, der Bogen der Auseinandersetzung spannt sich von der Frühaufklärung bis in die klassische Moderne – damit ist dann, geistesgeschichtlich gesehen, beinahe auch Schluß, eigentlich hören die Betrachtungen bei Adorno auf. So mühsam das scheint, gar intellektualistisch lähmend, steinern, so interessant und zugleich lebendig ist es auch. Die Entstehung dessen, was unsere (post-)moderne Welt geprägt hat und immer noch bestimmt, der Geburt der Aufklärung gilt Ritters vordringlichstes Interesse.
Die Form ist häufig anekdotisch und mitnichten mühselig, die Geschichten und Geschichtchen, die den eigenen Gedanken auslösen, sind mitunter boulevardeske Historien, die Essenz, und sei sie noch so knapp bemessen, ist dennoch fast immer bemerkenswert treffend. Sei dies eine Miniatur über die Malerin Elisabeth Vigée-Lebrun und prärevolutionäre bäuerliche Drohung gegen ihre herrschaftliche Kutsche; der Gedanke danach ist hell und klar, enlightened, aufklärend in Impetus und Inhalt, denn aus dem Zorn der Unterdrückten folgt für Ritter die immerwährende Hoffnung: »Morgen werden wir sein, was ihr seid und ihr werdet sein, was wir sind.« – er nennt dies, demi-sêc, den »populären revolutionären Affekt.«
Oder sei es, kurz danach im Textfluß folgend, die bescheidende und nicht unwahrscheinliche Infragestellung aller Interpretationen über die berühmte Kleist-Stelle über die grünen Augengläser, (»Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten …«) die als Kern der kleistschen Kritik an der kantischen Rationalphilosophie gilt. »Dabei hat man übersehen (sic!), daß Robespierre grüne Brillengläser getragen hat. … Ob Kleist bei seiner Frage an die grünen Brillengläser Robespierres dachte und also wissen wollte, was wäre, wenn alle Menschen wären wie Robespierre?« Es ist so einfach wie verblüffend, wie vermeintliches historisches Kleinwissen zu einer völlig neuen Perspektive führen kann. Solcherlei geistige Kunstfertigkeit fiel dann auch den Leipziger Juroren auf, die ihm den diesejährigen Buchpreis in der Kategorie »Sachbuch« zusprachen.
Dieser Ideen, wenngleich die letztgeschilderte sicherlich die plakativste ist, sind viele im Buch. Es ist es ein Nachschlagewerk interessierter Gedanken, und das sichert gewiß seine Beständigkeit. Und genau deswegen ist es ein Buch für das Jetzt und das Später, denn es ist nicht an irgendeinen fraglichen, persönlichen Ruhm gebunden, sondern an die Zeitläufte, aus denen es schöpft. Es ist der Zukunft zugewandt. Bestimmt folgt auch bald ein E‑Book.
Henning Ritter: Notizhefte (Amazon Partnerlink)

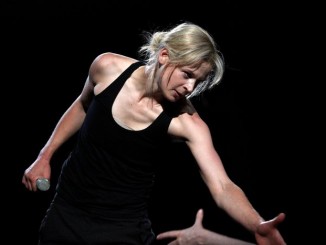

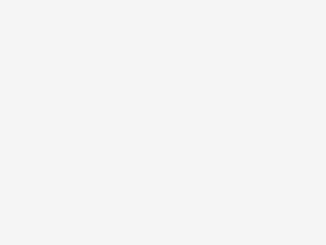
Hinterlasse jetzt einen Kommentar