Camouflage
Die allgemeine Bekleidungsvorschrift für den bundesdeutschen Literaturprofi ist und bleibt das Kordjacket. In der Regel hellbraun, gelegentlich schwarz, in seiner Reinform als komplettes Ensemble als Kordanzug inklusive Weste. Der landadelige Manufactum-Stil ist auch in der Saison 2010 noch ganz weit vorne, sei es beim Feuilletonchef oder auch bei Autoren. Das zeigt Kontinuität und ist auch modesoziologisch fest in der Intellektuellenszene verankert. Mindestens ein Kordsakko gehört zur Camouflage, um in den hellen Hallen in Leipzig nicht aufzufallen. Auffälliger und das Gegenteil von getarnt sind die Cosplayer, die die Messe bevölkern, junge Leute in den Kostümen ihrer Lieblingsmangas. Ein bißchen merkwürdig, ein bißchen schrill, aber bunt. Die Irritation ist schnell verflogen, bald hat man sich an die Mädchen mit Tierohren in den Haaren und weißhaarigen Teenager in Matrosenkleidchen gewöhnt. Was das wirklich zu bedeuten hat, mag den meisten Messebesuchern verborgen geblieben sein, es ist fremd und Bestandteil des Comic- und Graphic-Novel Programms. Die jungen Leute schreiten mit ernsten Mienen über die Messe, und es scheint ihnen wichtig zu sein.
Preisboxen
Preise gibt es in Leipzig viele, der Preis der Messe ging nicht an Helene Hegemann, was auch kein Wunder war, nicht etwa wegen des »Skandals«, der Leipziger Erklärung oder ähnlichem, sondern einfach wegen der Belanglosigkeit von Werk und Wirkung. Belletristik-Preisträger wurde Georg Klein, der verteilte Gänseblümchen in seiner Dankesrede und man fragte sich, ob diese Harmlosigkeit poetisches Mittel oder beißende Ironie angesichts der Gesichtslosigkeit des Preises war. Signifikant war die weitgehende Unfähigkeit der Jury zur freien Rede (lobenswerte Ausnahme: Zeit-Magazin-Redakteur Adam Soboczynski), nicht einmal das abgelesene Manuskript der Jurypräsidentin Verena Auffermann war frei von gewundenen Metaphernstilblüten. (»Dieser Igel ist kein Hase« – ist das intellektueller Eiskunstlauf?). Für den lauten Verlags-Betrieb eher unwichtig, aber viel schöner die Nachricht des Preises der Literaturhäuser für Thomas Kapielski. Der Preisträger, kein »grossser« Autor, ist ein origineller Schreiber mit Witz und Verstand, schön zu sehen bei seinem kurzen Interview mit dem Berliner Literaturhauschef Ernest Wichner auf dem arte-Stand. Klaus Wagenbach erhielt dann noch den Kurt-Wolff-Preis für sein Lebenswerk, eine Veranstaltung in aufgeräumter Stimmung – wie in seinem Wohnzimmer, mit vielen Freunden dabei und viele andere, die ihn offensichtlich mochten. Das war ein guter und freundlicher Moment in dem wilden Messetrubel, mit gelegentlich von anderen Ständen herüberwehenden Beifallsäußerungen, die diese Ehrung mit kleinen unbeabsichtigten Akzenten illustrierten.
Großlesung
Martin Walser las über Heine, Burkhard Klaußner las Heine und der Hoffmann und Campe Verlag brachte ein neues Heine-Buch heraus. Gemeint ist die Faksimile-Ausgabe der »Französischen Zustände« von 1832, ein sehr ehrenwertes verlegerisches Unterfangen, daß auf der Messe präsentiert wurde. Was hätte da würdiger sein können, als ein Essay eines deutschen Großschriftstellers verlesen zu bekommen und den Originaltext von einem der wenigen mitdenkenden Schauspieler zu hören. Der Ort war natürlich ebenso würdig gewählt, der Lesesaal der Deutschen Nationalbibliothek. An jedem Tisch zwei Leselämpchen und dahinter jeweils mit zwei, drei Plätzen bestuhlt, das ist schon der »Ort Lesung« an sich. Allein, die Sache war heikel – Walser ein untadeliger und von seinem Thema eingenommener Heine-Laudator, der Urtext aber ein gar sperrig Ding und von dem gewiss schönen Buch sah man ein einziges Exemplar unter Glas. Einnehmend war die Sache dann aber schon, kleine Versprecher des Verlegers amüsant (»Jenseitsnovelle« ist doch wohl von einem anderen Hoffmann & Campe-Autor und nicht von Martin Walser …?) und alle Anwesenden guter Dinger über das Erlebte.
Feuchtgebiet
Ein Nicht-Cord-Sakko-Träger ist Moritz Rinke. Der hatte am Zeit-Stand eine halbe Stunde Zeit, seinen ersten Roman zu präsentieren. Um es gleich zu sagen, das war rundum gelungen. Das Buch scheint ein seltenes Zeugnis dafür, wie jemand einen Text verfassen kann, der Humor und auch Selbstironie hat und trotzdem auf spielerischer Art mit großen Themen umgeht. Und der Autor versteht auffallend viel von Struktur und Dramaturgie. Rinke und sein Buch kommen sozusagen beide aus Worpswede, es hat viel mit den feuchten Niederungen des Moores zu tun, das diesen deutschen Kunstort umgibt. Es geht um Kunst und deutsche Geschichte, die sogenannte jüngere. Aber das oft bleierne solch eines Zeitenromans fehlt ihm gänzlich. Der Mann hat Distanz zum Stoff und zu seinem Literatentum. So etwas wie »Als Romanautor hatte ich plötzlich mit Dingen wie der Vorvergangenheit zu tun.« hört man in der Tat nicht allzu häufig. Das Wort »Humor« hat übrigens auch etwas mit Feuchtigkeit zu tun.
Zuguterletzt, die Bücher:
Georg Klein: Roman unserer Kindheit, Rowohlt 2010
Thomas Kapielski: Mischwald, edition suhrkamp 2009
Heinrich Heine: Französische Zustände, Hoffmann und Campe 2010
Moritz Rinke: Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel, Kiepenheuer & Witsch 2010


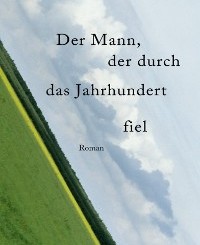
Hinterlasse jetzt einen Kommentar