

Die vollständige Textfassung des großen Interview mit Ludwig von Otting, das in unserem 13-minütigen Interview-Film “Der Ermöglicher” bereits auf dieser Seite des HAMBURGER FEUILLETONS zu lesen war. Der Text erscheint im Wochenrhythmus in drei Teilen.
Ortswechsel. Der zweite Teil des Gesprächs mit Ludwig von Otting findet in einer Loge des 1. Rangs statt. Im Hintergrund wird die Bühne des »Gestiefelten Katers« abgebaut und die Abendvorstellung vorbereitet. Wir fragen den Autor nach seinen literarischen Vorlieben und den Geschäftsführer nach der Verbindung zwischen Juristerei und Theater.
Wie kommt es zu dem Sujet ihres Buches, Piraten, Seefahrer etc., das klingt alles sehr kundig. Sind sie zum Segler geworden, hier an der Küste?
Ich hab von Seefahrt keinen Schimmer, aber natürlich versuche ich das ein bisschen zu verschleiern in meinen Büchern, in dem ich mir ein paar Informationen besorgt habe. Ich meine, ich habe heute noch die größte Mühe Backbord und Steuerbord und Luv und Lee zu unterscheiden. Es ist letztlich für die Geschichte auch nicht wichtig, aber es ist halt schon für die Authentizität von so Geschichten schon ganz gut, wenn man da so ein bisschen was weiß.
Da ist aber schon eine Faszination da für die Seefahrt und die Gefahren auf See?
Eine Riesenfaszination, klar, dieses ganze Unwesen, was die da treiben auf See, die Inseln, die Seeungeheuer. Ich hab mal ein paar Seeungeheuer erfunden, in dem Buch, was sie da liegen haben, den »Tyrannogurkus« und die »Mördermuschel« und den ganzen Krempel, das hab ich erfunden, weil ich mich geärgert habe.
Kurz nach Erscheinen meines ersten Buches in dem eine Riesenkrake eine Rolle spielte, kam dieser schöne Film, »Fluch der Karibik«, mit 3 oder 4 Folgen, und da spielt eben auch die Riesenkrake eine Rolle. Ich dachte, mich trifft der Schlag, natürlich wird jeder Mensch denken, ich hab das da geklaut.
Notfalls wäre ja nachzuweisen, dass der Erscheinungstermin meines Buches lange vor dem Film war – trotzdem ärgerts mich, und dann hab ich mir gedacht, wenn alle als erstes auf né Riesenkrake kommen kommen als Seeungeheuer, dann muss ich ein paar andere erfinden, und deswegen hab ich dann diese andern Ungeheuer eingebaut.
Das ist ja auch ein Topos bei Jules Verne, die Krake?
Das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube ja. Ichvermute, dass ich die meisten Sachen irgendwo geklaut habe aber leider nicht weiß, wo. Als Kind hab ich alles in mich reingefressen, Jules Verne und Robert Louis Stevenson, natürlich Mark Twain und Jack London, der ja auch unendliche Seegeschichten geschrieben hat Da kommt natürlich alles irgendwann irgendwo mal vor. Diese ganz Welt habe ich mir als Kind schon angelesen, und ich hoffe, dass es so speziell wieder rauskommt, dass man mich nicht wie Herrn zu Guttenberg bald der Plagiate überführen kann und sagen, das hast du aus dem Buch, und das hast du aus dem Buch. Ich bin ganz sicher, dass ich relativ viel aus anderen Büchern habe oder auch aus Erzählungen oder auch aus Filmen. Ich habe zum Beispiel als 15jähriger ein mehrbändiges Werk gelesen, ich weiß gar nicht wie das hieß, aber die Hauptfigur ist ein Lord Hornblower …
C. S. Forester …
Forester, genau. Eigentlich ein bisschen B‑Movie-mäßig, so eine Art Trashroman.
Der dann mit Gregory Peck verfilmt wurde, zumindet ein Buch daraus …
Ja, der ist ja dem Nelson nachempfunden, wie ich gehört habe. Aus dieser Geschichte habe ich ganz viel verinnerlicht. Mich hat auch Graf Luckner sehr interessiert. Also gelesen habe ich irrsinnig viele Seefahrtsgeschichten.
Horatio Hornblower hat als Schiffsjunge angefangen und ist dann bis zum Admiral aufgestiegen, ein Klassiker der Marineliteratur …
Ich hab das gerne gelesen, aber habe rückblickend das Gefühl, dass das eher trashig ist, ich habe auch Enid Blyton unheimlich gerne gelesen und das ist nun bei Gott keine Weltliteratur, aber das ist auch wurscht, ich finde, dass man als Kind so’n Zeug auch essen darf, lesen darf, reinfressen darf und muss, und das man das auch sozusagen mit in seine Welt aufnehmen kann.
Was lesen sie heute?
Fragen Sie mich nach meinen Lieblingsautoren?
Nein, eher was Sie zur Zeit lesen.
Jetzt im Moment lese ich zum Beispiel wahnsinnig gern Jasper Fforde. Keine Ahnung, wie man den ausspricht, mit zwei „F“ am Anfang. Das ist ein Waliser, der Bücher schreibt, die sich so ganz äußerlich als Krimis, Science-Fiction Krimis gerieren, aber die voll von Witz und Phantasie sind, wie ich’s ganz selten gelesen habe, das ist ein Lieblingsautor von mir, jetzt ein neuerer. Ich lese wahnsinnig gerne Sebald und ich bin ein großer Anhänger von Arno Schmidt, sehr heterogen sind meine literarischen Vorlieben.
Lesen sie Stücke?
Nein, gar nicht, Also nur im Zusammenhang mit Theater, zu meinem Vergnügen lese ich keine Stücke. Stücke sind auch nicht da um am Strand gelesen zu werden. Nein, ich lese Prosa und Lyrik, da hab ich meine Vorlieben. Jean Paul lieb ich sehr, Matthias Claudius, von den neueren eben Arno Schmidt, und dann gibt’s einen Autor, den überhaupt kein Mensch mehr kennt, den ich für einen bedeutender Nachkriegsautor halte, das ist Gregor von Rezzori, der wunderbare Romane geschrieben hat, damit meine ich jetzt nicht diese dämlichen, halbpornographischen, schnell hingeschmierten »Maghrebinischen Geschichten«, sondern so etwas wie »Ein Hermelin in Tschernopol«, das ist wirklich ganz große Literatur, die, finde ich, ihrer Wiederentdeckung harrt.
So eine KuK-Tradition ist da auch noch mit drin …
Der hat nun wirklich die ironische Distanz des alten, in seinem Fall nicht so ganz geklärten, Adelsgeschlechts zu einer bürgerlichen – und auch zu einer proletarischen – Gesellschaft wie kein anderer. Den find ich zum Beispiel persönlich wesentlich wichtiger als viele andere, die auch noch leben, deren Namen man sich nicht unbedingt merken muss.
Wir sie hier so entspannt in der Loge sitzen, die Beine hochgelegt, das hat so ein wenig was von Jolle. – »Alles Bolle auf der Jolle« ist eins der Lieder aus den »Ruchlosen Rivalen« …
Alles Bolle auf der Jolle. Meine Neigung zu Kalauern ist auch nicht gerade schwach ausgeprägt.
Wie ist denn die Reaktion im Haus auf den Katzenstein? Conny Schirmer hat die Musik gemacht, dann gibt es diese Lesung mit den wilden Jungs bei Literaturfestivals. Das sieht schon wohlwollend unterstützend aus, sehr dicht dran.
Ja, also, ich sag mal, die Leute nehmen es teilweise wahr und teilweise nicht wahr, negative Reaktionen kenn ich keine, das sagt einem auch keiner, wenn einer es liest und es Scheiße findet. Sie sagen entweder gar nix oder was nettes. Also der Joachim Lux ist eigentlich der erste Intendant, der ein bisschen drauf reagiert und es auch seinen Kindern geschenkt hat. Ich fühl mich da ganz wohl.
Joachim Lux, der Intendant – das Spiel zwischen Intendant und Kaufmann … haben Sie über die Jahre eine besondere Technik entwickelt, mit all diesen unterschiedlichen Intendanten und Künstlern klarzukommen? Sie sind der »Geldverteiler« haben sie mal gesagt, der dafür sorgt, dass die Künstler im Haus frei arbeiten können. Kann man das noch präziser ausdrücken, für Leute die sich unter einem kaufmännischen Geschäftsführer am Theater nicht so viel vorstellen können?
Was mich eigentlich wundert, dennd as kaufmännisch-finanzielle ist als Berufsbild wesentlich mehr verbreitet als die künstlerische Leitung.
Aber ich meine, so ein Theater hat einen jährlichen Bedarf von 25 Millionen Euro. Davon verdient das Theater einen Teil selber, etwa 5 Millionen, der Rest wird als Subvention da hingelegt. Und meine Verantwortung ist es, ich mach das ja nicht alleine, meine zentrale Verantwortung ist dafür zu sorgen, dass das Geld auf anständige Weise ausgegeben wird.
Dazu gehört in einem gewissen Umfang sicher auch, dass man sparen kann, dass man Sparvorgaben durchsetzen kann, es ist ein furchtbares Missverständnis, wenn Leute glauben, dass ich prinzipiell glücklich bin, wenn irgendetwas wenig kostet oder besonders hohe Einnahmen macht.
Natürlich freue ich mich über jedes Stück, das Erfolg hat, aber mein Job ist es nicht, die Subventionen nicht auszugeben, sondern sie auf vernünftige und anständige Weise auszugeben. Seriös und so, das möglich viel dabei rauskommt. Das mach ich auch keineswegs alleine, es wäre albern, so zu tun, als ob ich mir den Gesamterfolg alleine an den Hut heften könnte. Das ist ein sehr komplexes System mit sehr eingespielten Leuten.
Ich habe wahnsinnig gute Mitarbeiter auf den verschiedenen Ebenen, in den verschiedenen Bereichen mit denen das dann auch ganz gut funktioniert. Und der Zusammenhang, die Zusammenarbeit mit dem Intendanten ist natürlich auch ganz wichtig dafür und das hab ich eigentlich in allen drei Fällen so leidlich hingekriegt
Gibt es eine langfristige Planung, die über Spielzeitplanung hinausgeht? Gibt es einen Masterplan über die Jahre, etwas wie „Wir werden etwa in 10 Jahren da etwas machen müssen?“
Naja, klar, gerade die gesamte Theaterstruktur ist ja keine, die sich nur von Spielzeit zu Spielzeit fortschreibt. Zunächst einmal ist die Laufzeit eines Intendantenvertrages ein ganz wesentlicher Parameter. Ein Intendant hat fünf Jahre Vertrag, der wird dann auch irgendwann mal verlängert, für so eine Ägide denkt man auch, was die Instandhaltung des Hauses, die Anschaffung technischen Equipments, Ausbauten, Anbauten, Umbauten und dergleichen anbelangt und das sind durchaus Dinge, die in die Zukunft reichen. Wenn man so etwas wie die Gaußstraße macht, dann weiß man, dass das ein Projekt ist, das weiter reicht.
Gibt’s eine Einmischung in den akuten künstlerischen Betrieb, dass man sagt, diese Produktion wird zu teuer, hört jetzt mal auf hier?
Das gibt es natürlich wirklich, wobei es nicht so funktioniert, wie Sie es eben beschrieben haben. Man muss von vorneherein die Gelder so budgetieren, wie man glaubt, dass es vernünftig ist. Und wenn dann so ein Budget an die Grenzen stößt und eine Produktion mehr haben will, mehr braucht, mehr zu brauchen meint, dann steht man vor der Entscheidung, ob man das verweigert oder ob man irgendwo noch ’né Reserve hat oder so was.
Das ist natürlich eine ganz zentrale Aufgabe von mir, da mit Augenmaß und Liebe zum Theater, unter Einschätzung der Potentiale, die da sind, die Entscheidung vorzubereiten. Ich fälle die aber nicht alleine, so eine Entscheidung fällt man nicht im einsamen Kämmerlein, und überrascht den Intendanten dann mit ’ner Aktennotiz: »Habe soeben die Zusatzmittel für Stemann gestrichen«, da muss man natürlich gemeinsam dran und mit dem Regisseur und dem Bühnenbildner und der Werkstattleitung und allen anderen sehen, was unbedingt notwendig ist und dann findet man immer Kompromisse.
Stemann ist in diesem Zusammenhang wirklich ein gutes Stichwort. Von ein paar Jahren gab es da einen sehr eklatanten Eingriff in die künstlerische Arbeit in der Diskussion mit einem Jelinek-Stück.
Ja, aber von außen, nicht von innen.
Es geht die Geschichte, sie hätten mit einem Team auf die Striche geachtet, ob bestimmte Textstellen nun justiziabel werden können oder nicht.
Das passiert häufiger. Ich meine, es gibt bestimmte Stücke, bestimmte Autoren, bestimmte Verlage, bei denen es höchst problematisch ist, ein Stück interpretatorisch zu verändern. Allen voran ist das Brecht, am schlimmsten da die »Dreigroschenoper«, wenn sie da ein falsches Instrument einsetzen, haben sie die Weill-Foundation am Hals.
Aber es gibt auch immer wieder moderne Stücke, die irgendwelche Fälle aufgreifen, wo man sehen muss, dass man nicht mit den Persönlichkeitsrechten von jemandem in Konflikt kommt. Und das Stück, von dem sie sprechen, das war eine Jelinek-Text, »Ulrike Maria Stuart«. Die Jelinek selber hat überhaupt kein Problem mit jedweder Veränderung, die verhält sich vollkommen relaxed gegenüber Regieeingriffen, fordert die nachgerade.
In dem Fall war’s eine andere Autorin, die da zitiert wurde in dem Stück, die sich verletzt und beleidigt fühlte. Und es gab vor allem die Tochter von der Ulrike Meinhof, die Mitwirkungsrechte beanspruchte, die wir ihr nicht einräumen wollten, und da gab’s mächtig viel Zoff. Und da setzt man sich natürlich hin und guckt sich das genau an und versucht erst einmal selber zu beurteilen, ob eine Rechtsverletzung vorliegt oder nicht. Wir haben Anwälte dazu geholt und dann entschieden, dass das, was wir da machen, so gemacht werden kann. Dann gab’s zwar einen Prozess, aber der ist für uns positiv ausgegangen.
Wie fassen das dann die Künstler auf, sagen die dann »Finger weg, wir wollen das durchsetzen«?
Das ist sehr unterschiedlich. Der Stemann ist ja ein hochintelligenter Mann, der weiß genau, was er treibt. Der ärgert sich natürlich über jede Grenze, die ihm gesetzt wird, und versucht die irgendwie zu auszudehnen oder zu durchbrechen, aber letztlich ist das jemand, mit dem man reden kann und der Argumenten zugänglich ist.
Es gibt aber auch Leute, die überhaupt nicht zugänglich sind. Da muss man es unter Umständen zulassen oder mit Gewalt verhindern, das passiert dann schon, aber ganz selten. Im Grunde sind das alle Vorgänge von enger Zusammenarbeit, langer Diskussion und gemeinsamem Ergebnis. Eigentlich ist Theater auch nur so gut und kann auch nur so was werden.
Ich vermag mich überhaupt nicht zu sehen in Opposition oder gar in einer Feindschaft zu den Kreativproduzenten, zu Regisseuren, zu Dramaturgen oder Bühnenbildnern, sondern ich sehe mich als ein Ermöglicher, zumindest als jemand, der solche Sachen freundschaftlich begleitet und versucht, die Produktionsbedingungen so gut zu gestalten, wie es eben geht.
Lesen sie nächsten Montag, im dritten und letzten Teil, Ludwig von Ottings Meinung zur Hamburger Kulturpolitik und über die Inszenierungen, die er nicht vergessen mag …

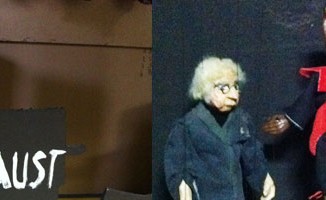
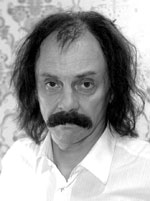
Hinterlasse jetzt einen Kommentar