

Bis auf den letzten Platz besetzt ist das Thalia-Theater, wenn »die Burg« an der Alster zu Gast ist. Peter Jordan, jahrelang festes Ensemblemitglied des Thalia-Theaters, kommt aus der Wiener Fremde auf die noch leere Bühne und spricht – ausgerechnet über Heimat: einen Text des 2008 verstorbenen Rechtspopulisten Jörg Haider, wie man im anschließenden Publikumsgespräch erfährt (leider aber nicht aus dem Programmheft). Haiders Heimat-Kult dem Stück voranzustellen, gesprochen vor idyllisch projiziertem Alpenpanorama, funktioniert erschreckend gut und steht Stephan Kimmigs Inszenierung programmatisch voran. Denn es geht in erster Linie um räumliche und innere Heimat – und das Gefühl von Bedrohung derselben durch das Fremde.
Alfonso VIII., König von Kastilien (Peter Jordan), hat unruhige Zeiten zu bekämpfen im Toledo des Jahres 1195. Angegriffen wird die Stadt nicht nur von Außen durch den »grimmen Mauren«, auch im Stadtinnern brodelt der Hass gegen die Juden. Bühnenbildnerin Katja Haß hat die Handlung in einen Gerichts- und Parlamentssaal verlegt. Warum, liegt auf der Hand, denn hier geschieht Unrecht. Doch das ist auch schon der einzige Pluspunkt für diesen beengten Guckkasten in hellen Holztönen. Dominant hängt das Kruzifix an der Stirnseite. Der König spricht zu seinem Volk, und die Familie steht ihm bei wie aus dem Ei gepellt. Viel zu früh hat man Alfonso ins Amt gesetzt, die Heirat mit Eleonore von England geschickter Schachzug der Eltern. Die perfekte politische Inszenierung, obwohl der Frau Gemahlin das Lächeln schon mal entgleist. Man neigt zum Gebet für Toledo züchtig das Haupt, dem Kind werden die dicken Händchen gefaltet.
Da wirft sie sich ihm vor die Füße, das junge Ding. Schön ist sie und stolz und will den König sehen, davon können weder Vater noch Schwester sie abbringen. Sie fleht um Schutz gegen die Juden-Verfolgung – und spielt doch das Spiel der Verführung. Lebenshungrig ist diese Rahel der jungen Yohanna Schwertfeger, eine Gierige, die Grenzen austestet und ihr ganzes Sehnen in den Moment legt. Als würde das Leben hereinbrechen in eine tote Kulisse wirkt es. Und um Alfonso ist´s geschehen. Hunger hat er jetzt. Oder zumindest Appetit.
Ein liebestoller König, der – statt Toledo, die Heimat der Christen, im Krieg zu verteidigen – lieber im Lustschloss Cowboy und Indianer spielt: Zauberhaft leicht ist die kindische Liebes-Verrücktheit der beiden und von kurzer Dauer. So etwas darf nicht sein, das begreift der pflichtvergessene Alfonso schnell. Er wurde verhext, das Fremde, Voodoo, was auch immer, es zog ihn in seinen Bann. Bei der Rückkehr nach Toledo trifft er auf die betrogene, gedemütigte Gattin, die im Gespräch mit den Granden das Todesurteil über Rahel längst verhängt hat. Zweimal spricht Caroline Peters als Eleonore das Urteil an diesem Abend, einmal zu Beginn, das Ende vorweg nehmend. Die Grenze zwischen Privatem und Politik ist eine fließende. Letztlich ist man sich einig, das Fremde muss weg, es schadet dem Staat. Was nun folgt, ist kein Einzelmord, es ist ein Progrom, wie ein Meer aus Grablichtern auf der Bühne andeutet: Ausgerechnet Don Garceran, der die »jüdische Dirne« selbst begehrte bis zur Vergewaltigung, macht der Trauer des Vaters und der Schwester mit dem Feuerlöscher ein Ende.
Zwei Arten von Fremdheit wolle Regisseur Kimmig zeigen, sagt seine Dramaturgin im Publikumsgespräch: Das Fremde, das unsere gewohnte Welt von außen bedroht, und die Angst vor dem Unbekannten im eigenen Innern. Alfonso begegnet beidem, als er das Gefühl von Begehren kennenlernt. Und aus Angst und Scham vor seinem fremden Selbst wird die Ursache für die Emotion verantwortlich gemacht: die jüdische Geliebte. Insgesamt will der Abend ein bisschen zu viel und gleitet so manchmal ab ins Plakative. Dennoch ist Kimmig eine Studie zum Thema Fremdheit gelungen, die sich gewaschen hat. Was Grillparzer in diesem Stück tut, ist so ungebremst, wenn auch in strenge Verse gepresst, dass man unweigerlich »Sturm und Drang« denkt: Sieben Figuren auf der Bühne, und keine ist nur gut, keine nur schlecht. Jede hat ihre Begehrlichkeiten, Leidenschaften, Fehler. Und mit Sicherheit ist es Kimmig zu verdanken, dass diese inneren Widerstände nahezu plastisch greifbar sind. Eine junge Frau will nichts mehr als leben. Und ausgerechnet die ist am Ende tot.


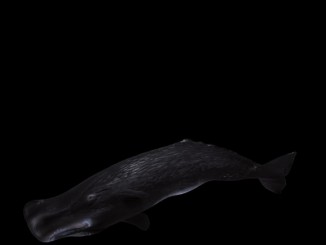
1 Trackback / Pingback