

»I have a voice in my head« steht über dem Eingang der Opernhaus-Kulisse, deren Front die gesamte Bühnenbreite einnimmt. Von drin hört man das Orchester die Instrumente stimmen, das Publikum (der Chor) strömt hinein, die Vorstellung fängt gleich an. Rückwärts kommt eine Sängerin im Carmen-Kostüm aus der mittleren Tür. Erst vorn an der Rampe dreht sie sich um, blickt ins Publikum – und beginnt zu singen.
Rinat Shaham heißt die Sängerin, deren starker Mezzosopran sich durch den Abend zieht, immer wieder unterbrochen und gestört, nie mit instrumentaler Begleitung. Sie habe das Stück durch Gespräche mit Simon Stephens geprägt, wie der in seinem kurzen Vorwort dafür schreibt: »Ich bin ihr für ihre Großzügigkeit, die mir Einblicke gewährte, und ihre Offenheit zu großem Dank verpflichtet.« Auch der Regisseur des Abends wird im Vorwort erwähnt: Sebastian Nübling, mit dem ihn eine jahrelange Zusammenarbeit verbindet, habe die Entstehung der Carmen-Bearbeitung »provoziert«, schreibt der Autor.
Nübling gilt fast als Garant für erfolgreiche Uraufführungen von Stephens‹ Stücken. Seine Regiearbeiten werden mit schöner Regelmäßigkeit zum Berliner Theatertreffen eingeladen – so geschehen u. a. mit Händl Klaus‹ »Dunkel lockende Welt« oder – natürlich – Stephens’ »Pornographie«. Mit der Opernversion von »Carmen« eröffnete Nübling 2006 an der Staatsoper Stuttgart die Spielzeit. Ihn jetzt für diese Stephens-Interpretation des Carmen-Stoffes »Carmen Disruption« ans Schauspielhaus zu holen, passt perfekt in die konzeptionell kluge und stilsichere Eröffnungsspielzeit einer Karin Beier. Nicht nur, dass Nübling eine enge Freundschaft zu Stephens verbindet und er den Carmen-Stoff von der Opern-Seite kennt: Er ist Schauspielregisseur und gleichzeitig Grenzgänger zwischen den Sparten, arbeitet auch gern mit Tänzern zusammen.
Von den Figuren der Carmen-Oper ist bei Stephens nicht mehr viel übrig. Sie sprechen viel und haben doch keine Worte. Ausdrucksstark sind sie in der Bewegung. Nübling hat mit seinen Schauspielern eine Auftaktchoreografie erarbeitet, die viel sagt vom Ringen mit diesem Ding, das man Gegenwart nennt oder Leben. Eins ist allen gemeinsam: Sie sind müde und aufgekratzt, verliebt und verzweifelt, verwegen und am Abgrund. Und insgesamt sind sie alle irgendwie »disruptet«, gestört, überfordert von einer Diskontinuität der Ereignisse, Zerrissene. Sie alle haben nichts miteinander zu tun.
Aus der Hauptfigur Carmen wird ein überdrehter Stricher, der sich auf einer Woge von Selbstverliebtheit und Selbstbetrug zu seinem Freier aufmacht. »Ich sehe mich kurz im Spiegel, als ich in die Küche gehe, um mir vom Herd einen Kaffee zu holen, und ich bin selbst überrascht, weil ich verdammt scharf aussehe.« Christoph Luser nimmt sich diese Rolle mit einer Lust an Extravaganz und Extremität, geschmeidig wie eine Raubkatze, hin und wieder gewürzt mit einem derben österreichischen Akzent, in den die Figur abdriftet. Das Fläschchen Poppers und das Gleitgel in seiner Umhängetasche werden ihm heute nicht weiterhelfen. Der Abend wird böse enden.
Auch die Sängerin ist müde. Sie hat in so vielen Hotels und Airbnb-Wohnungen übernachtet, dass sie nicht mehr zu wissen scheint, in welcher Stadt sie gerade ist. Hat der Agent aus New York immer noch nicht angerufen? Sie steigt aus den Schuhen, nimmt ihre Perücke ab, setzt ihre Schlafmaske auf und legt sich nieder. Diese Schuhe werden an diesem Abend nahezu alle Figuren tragen, am besten gehen kann damit aber zweifelsfrei Christoph Luser.
Seine Carmen hat so viele knappe Westchen, dass jeder Bolero vor Neid erblassen würde. Kostüm ist alles, je bunter das Leben, desto weniger weh tut es. Nach der Vergewaltigungsszene, in die seine Begegnung mit dem Freier mündet, stöckelt er wacklig, aber immer noch elegant ab wie eine geprügelte Schönheitskönigin.
Escamillo alias Samuel Weiß, der den ersten Teil des Abends damit verbringt, sich mit großer spanischer Geste Luft zuzufächeln, zieht sich eine riesige Line Koks. Auch er ist in so vielen internationalen Hotels unterwegs, dass er die Stadt, in der er sich aufhält, nicht mehr kennt. Doch seine Fassade ist brüchig. Er braucht Geld, und zwar dringend. Er wird alles aufs Spiel setzen in einem einzigen Gespräch, und er wird es bekommen. Nur die Frau im roten Kleid, die bekommt er nicht. Aber das ist nicht so schlimm, denn er liebt seine Ehefrau, wirklich, das müssen Sie ihm glauben.
Auch Don José (Julia Wieninger) hat ihre Kinder geliebt. Heute ist sie Taxifahrerin und lebt auf diesen einen Moment hin, in dem sie ihren Sohn das erste Mal wieder sieht. Sie hat ihre Familie verlassen für einen anderen Mann, der heute tot ist. Aber sie liebt ihre Kinder, wirklich, das müssen Sie ihr glauben. Sie dreht ein paar krumme Dinger ab und an, und die Geste mit der ihr Sohn ihr den Tee einschenkt und beiläufig genau die richtige Menge Zucker hineinrührt, bringt sie zum Weinen. Denn das zeigt doch, dass er sie erkannt hat, im tiefsten Innern gesehen hat, oder nicht?
Und was wird aus Bizets Bauernmädchen Michaela? Von ihr sind nur noch die Gummistiefel übrig, und sie bekommt ihren tapferen Soldaten natürlich nicht. Diese Michaela liebt verzweifelt einen alternden Professor in der Midlife-Crisis, für den sie via Skype alles tut. Ihre Brüste zeigen, eine schlechte Seminararbeit schreiben, Selfies schießen, bei denen man sich fragt, wie so etwas anatomisch möglich sein soll. Ihre Sätze beginnen meist mit »Alexander hat mich verlassen, weil …«. Sie versucht, sein Fenster zu erklettern und schlägt sich die Knie dabei blutig. Den Motorradunfall, der alle Figuren schließlich verbindet, weil sie zufällig zur gleichen Zeit an der gleichen Kreuzung waren, kann sie der Polizei nicht beschreiben. Sie sieht nichts mehr.
Am Ende rückt die Front des Theaterhauses bedrohlich nah nach vorn. Die oberen Arkaden sind nur Kulisse, in den Bögen stehen alle Schauspieler und ein halbnackter Mann mit Stierkopf. Auch die Türen der Opernfront werden durchleuchtet, man sieht die nackte Hinterbühne, auf der der Statisten-Chor eilig nach Anweisung marschiert. Plötzlich ist alles nur noch Kulisse, ist die Welt Bühne. Und am Ende sehen wir wieder die Sängerin, die rückwärts schreitet, langsam, ganz langsam.
Nachtrag: der Chor – fast alle Texte des Chors wurden gestrichen. Seine Aufgabe ist zuarbeitend. Mal ist er Theaterpublikum, mal Kulisse für die große Bühnengeste der Sängerin, am Ende tanzen sie die Anfangschoreographie der Hauptfiguren. Ob man dafür 35 Statisten braucht, ist die Frage. Insgesamt war vielleicht ein bisschen wenig Zeit, diesen großen, fragmentarischen Stoff zu Ende zu denken. Ein starker Text, von dessen Opernvorlage nicht viel übrig bleibt. Es gibt »Buhs« für das Leitungsteam beim Applaus, eine Frau im Foyer sagt zu ihrer Freundin: »Ein bisschen mehr Carmen hätte ich mir schon gewünscht.« Egal. Sind wir nicht alle ein bisschen disruptet?


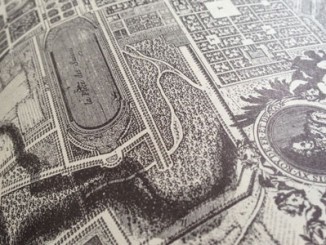
Hinterlasse jetzt einen Kommentar