
In der besten englischen Theater-Tradition steht das Genre der Farce, der tragikomischen und grotesken Überzeichnung. Ein wesentlicher Motor dieser Form ist das genaue Timing, das rasche Widerspiel von Rede und Gegenrede, und der direkte Zugang zur Pointe und zur manchmal grotesken Überzeichnung. Der große Regisseur Peter Zadek, geschult in der Tradition des traditionellen englischen Unterhaltungstheaters, schätzte diese Spielart sehr, er inszenierte mit Ayckburn, Behan und Ionesco Meister dieser Gattung.
Auch im literarischen Unterhaltungsgenre ist die Zeit ein Faktor von großer Bedeutung – weder Crichton, noch King, noch Harris funktionieren ohne die genaue Konstruktion und die exakte Abstimmung der Dialoge, ohne das Hinarbeiten auf dem Moment der Auflösung, mit all den Volten und Arabesken, die den Leser in die Irre führen können und dann auch ins Ziel. Über diese Form des Handwerks zu sprechen, gilt vor allem hierzulande als verpönt, zu weit entfernt ist sie vom Gedanken literarischen Genius und dem Momentum des alleinschaffenden Künstlers, der aus seiner alleinigen Inspiration schöpft.
Das Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kobr sind ein echter Gegenentwurf zu dieser Idee. Sie beherrschen das Handwerk, schreiben im Team, die Abstimmungen zwischen ihnen finden nicht in verrauchten Dichterstuben statt, sondern werden beinahe ausschließlich per Skype getätigt. Wie sie meinen, ist dieses Verfahren der Konzentration auf das gemeinsame Projekt zuträglicher als der direkte Austausch.
Mit ihren Regionalkrimis rund um den kauzigen Kommissar Kluftinger aus dem Allgäu haben sie auf diese Weise ein neues Sub-Genre geschaffen. Genau wie die schon erwähnten großen Kollegen beherrschen sie Konstruktion und Zeitgefühl, führen Dialogregie und Pointen mit großer Genauigkeit aus. Das ist sicher, neben der Wiedererkennbarkeit der regionalen Charaktere, der Hauptgrund für den Verkaufserfolg ihrer Kriminalromane.
Mit dem jüngst erschienenen Ferienroman »In der ersten Reihe sieht man Meer« sind sie, obwohl es sich mit Sicherheit nicht um einen Kriminalroman handelt, ihrer stupenden handwerklichen Könnerschaft treu geblieben. Auch in diesem Buch – es geht um eine Art Zeitreise in den deutschen Italientourismus der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts – gibt es liebenswürdige Charaktere, mit denen man sich rasch identifizieren kann, knapp skizzierte Genreszenerien und stets den unbedingten Willen zum Abschluss, zur Pointe, zur Auflösung. Die professionelle Handschrift der beiden ist unverkennbar.
»In der ersten Reihe sieht man Meer« erzählt die Ferienerinnerungen des pubertierenden Knaben Alex. Genauer handelt es sich um eine Art Rückblende, wie wir sie aus genreähnlichen Vorbildern aus Kino und Fernsehen kennen – eine Gedankenreise in die Vergangenheit. Der erwachsene Alex, von Beruf Werber, steht kurz vor der Abreise in den Familienurlaub nach Italien. Bei den letzten Verrichtungen am Vorabend der Reise, findet er ein altes Fotoalbum und erinnert sich an den ersten gemeinsamen Italienurlaub mit seinen Eltern, seiner Großmutter und seiner älteren Schwester.
Er fällt, nach dem für solche Fälle obligatorischen Glas Rotwein, in eine Art komatösen Schlaf und erwacht, vermeintlich, in seinem alten Kinderbett, aus dem er von seiner Mutter geweckt wird. Das Szenario ist ähnlich wie in der Realität, es ist der Tag des Aufbruchs nach Italien, nur ist der erwachsene Alex im Körper seines jugendlichen Alter Egos gefangen.
Die Kombination aus der Erfahrung des Mittvierzigers gebunden mit der physischen Erscheinung des pubertierenden Jungen und seiner Umwelt trägt in der Fortführung der Geschichte nicht unwesentlich zum Vortrieb bei. Der Motor dieser Rahmenhandlung läuft noch etwas unrund, wirkt zu konstruiert, doch schon bald summt der Handlungsvortrieb mit der Geschmeidigkeit einer »Bella Macchina« aus Turin oder Modena. Jedes der kurzen Kapitel – fast möchte man sagen, »Szenen« – ist mit dem immer einigermaßen passenden Titel eines Hits der 80er Jahre versehen, von »Felicitá« bis »Sternenhimmel«. Die genaue Verortung in seiner Handlungszeit ist wichtig, steht sie doch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Biographie der Autoren und ihrer anvisierten Zielgruppe.
Der Rahmen ist nostalgisch – popkulturelle Erinnerungsmeme für die Generation der in dieser Zeit Aufgewachsenen wie jene Chartstitel gibt es zuhauf. Der romantische Funken der Authentizität wirkt aus Hinweisen, dass die den Kapiteln vorangestellten Abbildungen, Postkarten wie Urlaubsbilder aus dem persönlichen Besitz der Autoren stammen. Der verklärende Blick auf diese Epoche schafft starke Identifikationen. Es soll Studien geben, nachdem beinahe 50 Prozent der Deutschen die Epoche zwischen 1980 und 1989 als Sehnsuchtszeit wieder installieren würden – trotz Frisurenmode und Euro-Pop.
Inwieweit die Zeiten sich verändert haben, blitzt an allen Enden in der Alltagstrivialität dieses kleinen Ferienbuches durch. Noch immer sind für die deutschen Touristen der Achtziger die Gastgeber jenseits der Alpen mit Vorsicht zu genießen, das Ressentiment gegen das Fremde, »den Italiener« ist allgegenwärtig. Insbesondere die unmittelbare Nachkriegsgeneration, Alex‹ Eltern und Großeltern, ergehen sich in den kuriosesten Manövern ihre Fremdheit und Ängste unter Kontrolle zur bringen.
Deutsche Nahrungsmittel werden in das ohnehin mit dem deutschen Hausstand schon völlig überladene Auto gestopft, die Mutter wäscht in der Ferienwohnung sämtliche Schränke mit Essigwasser aus und auch sonst ist jener merkwürdigen Spezies der »Eingeborenen« nicht zu trauen. Am Strand wird die deutsche Pommes-Bockwurst jeder italienischen Köstlichkeit vorgezogen – bis sich das erwachsene Ich des Protagonisten mit all seinem Wissen der posttoskanisch-hedonistischen Ära der Regierung Schröder und deren Folgen meldet. Tatsächlich wird dann vor allem auf kulinarischem Wege die »Strada del Sole« zur unvermeidlichen deutsch-italienischen Freundschaft befahren.
Der Weg dahin allerdings ist steinig und genretypisch voller Abzweige, die allerdings sind »con amore« beschrieben. Entlarvend ist der Zeitensprung gelegentlich auch für die Gegenwart. In einer höchst skurrilen Szene versucht der Familienvater, natürlich ohne Sprachkenntnisse – die hat allein und rudimentär seine Frau, in der Volkshochschule erworben – in einer italienischen Eisdiele erfolglos einen »Eisneger« zu bestellen. Ein Wort, das in heutiger Zeit wie selbstverständlich »nicht mehr geht«. Es handelt sich übrigens um eine Eiswaffel mit Schokoladenglasur auf den Eiskugeln, das hat man vielleicht vergessen. Aber »Bucatini all’amatriciana« kennen wir inzwischen.
So ist das alles höchstvergnüglich und unterhaltsam, angefüllt mit feinen und auch gelegentlich kalauernd-groben Spitzen, grotesk überzeichnet und, gen Ende, auch ein wenig sentimental ins Versöhnliche gesteuert. Aber das kann man durchaus zur eigenen Unterhaltung selbst nachlesen, an der Adria, im Allgäu oder in Bielefeld. Im Sommer.
»In der ersten Reihe sieht man Meer« kann man in der Buchhandlung oder auch bei Amazon [Partnerlink] kaufen:
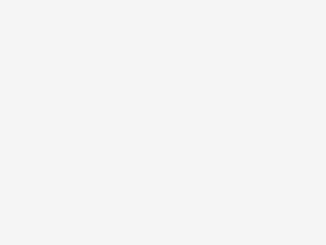


Hinterlasse jetzt einen Kommentar