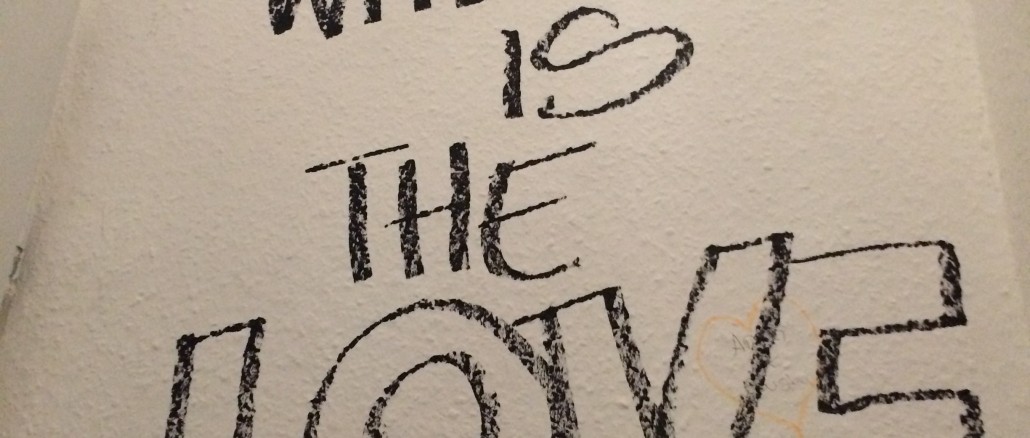
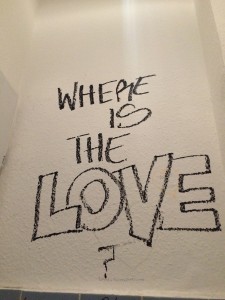
Die Bühne ist nackt, das Licht kalt. Einen anderen Einstieg hätte Brecht wohl selbst nicht gewählt. Und da kommt er auch schon, im Blaumann, die Schiebermütze auf der Stoppelfrisur, Zigarre im Mundwinkel. In schönstem Brecht-Geschnarre erklärt Jörg Pohl die Figur des Peachum. Er pfeffert die Mütze ins Eck, und schnell wird klar, Peachum-Brecht-Pohl hat´s nicht leicht. Das Geschäft mit dem Elend liegt darnieder, die Menschen sind abgestumpft, und wenn gebettelt wird, dann bitte, muss das Elend überdeutlich, es muss überhöht sein.
Eine ganze Batterie an Stümpfen und ähnlich bestürzenden Requisiten habe Peachum dann auch in seinem Lager, so erzählt er, denn er weiß auf der Klaviatur des Elends zu spielen. Filch, der sich als Bettler in Peachums Elends-Manufaktur bewirbt, muss sich gleich hinter die Ohren schreiben, dass halbe Sachen niemanden nach vorne bringen. Auch Filch (Paul Schröder) ist Brecht im Blaumann, und Peachums Frau (Victoria Trauttmannsdorff) ebenfalls. Und so wird Filch, als er die Leidensgeschichte seines Lebens vorträgt, sprachlich und darstellerisch gleich von zwei Peachum-Brechts korrigiert.
Antú Romero Nunes stellt sein Ensemble als eine Vielzahl an Brechts auf die Bühne, alle mit der obligatorischen Kurzhaarfrisur, mit Nickelbrille, Schiebermütze und Zigarre. Alle paffen und schnarren ganz herrlich und polieren schon auch mal eine Szene, die so noch nicht passt. Das muss wiederholt werden, so spielt man das doch nicht, das ist der Untergang des Stadttheaters. Von Beginn an wird konsequent schönste Brecht-Verfremdung ausgestellt. Die Schauspieler erklären ihre Figuren oder die Szene, Regieanweisungen werden gesprochen, Handlungen pantomimisch dargestellt.
Nunes hat seinen Brecht gelesen und versteht es, die Theorie der Verfremdung in Szene zu setzen, um sie sofort wieder zu brechen. Sein Ensemble aus acht Brechts sowie seine ausgezeichnet geführte Brecht-Band unter der Leitung von Johannes Hofmann agiert mit Können, Komik und Verve in und abseits der Rollen. Nunes verzichtet durch seinen – vermeintlich – nüchternen Stil auf die gern aufkommende Dreigroschenoper-Romantik. Den Mackie-Messer-Song, den Gassenhauer des Abends, enthält er uns bis zum Ende vor. Erst dann darf der Haifisch Zähne zeigen, und auch das wird gebrochen, wo es nur geht, auf dass ja keine Schunkelstimmung aufkommt. Auch der Surabaya-Jonny läuft nur instrumental in der Hochzeitsszene von Mackie Messer und Polly.
Was ausgezeichnet zu der Skizzierung der Brecht´schen Vorstellung von Liebe passt: Dieses Rohe, Unbehauene, das gewaltvoll Soghafte, das Wilde, das in erster Linie körperliche Liebe ausmacht, diese Grobheit und Egozentrik, die irgendwann bei Brecht in der Beziehung zu seinen Frauen zutage kam, glaubt man den Biografien – all das lässt sich trotz Blaumann und Feinrippshirt zwischen Mackie Messer und seinen Geliebten erkennen. Im Programmheft ist nicht umsonst Marie Luise Fleißers Beziehungsrückschau auf „den Mann“ zu lesen. Ihre Liaison mit Brecht war von extremem Ungleichgewicht geprägt.
Der Tango zwischen Mackie Messer (Sven Schelker) und Spelunken-Jenny (Franziska Hartmann), der so gekonnt mit Nähe und Ferne spielt, ist nur ein Beispiel. Auch die tieftraurige und urkomische Hochzeitsszene im Gangster-Milieu lässt den Zuschauer so verlassen zurück, wie nur die gebrochene Hoffnung auf wahre Liebe es vermag. Die Frauen übrigens sind bei Nunes kein Stück besser als Mackie. Polly (Katharina Marie Schubert) beispielsweise knutscht auf ihrer Hochzeitsfeier mit Begeisterung die gesamte Verbrecherbande nieder, wenn Mackie Messer und Kommissar Braun zum Kanonensong ansetzen. Um es kurz zu machen: Romantik gibt es weder bei Brecht noch bei Nunes.
Zusätzlich hat Nunes ein ausgezeichnetes Gespür dafür, Brechts Komik noch ordentlich aufzupolieren. Im Hurenhaus geht´s zum „Frühsport“ um 16.30 Uhr, Beckenboden- und Brustmuskelgymnastik versteht sich. Die abgebrühten Damen in Feinrippunterwäsche und High Heels bringen ihren Hurenalltag ungerührt hinter sich – auch den Blowjob nach dem Arbeitstag, der naturgemäß morgens endet.
Natürlich bekommt Mackie am Ende das, was er verdient: gleich zwei liebende Frauen, die im Kerker stehen und ihren Ehemann zurück wollen. Eine der besten Szenen des Abends: das Eifersuchtsduett zwischen Lucy Brown und Polly Peachum. Der Kniff: Mit Anna Maria Torkel holt Nunes sich für diese Szene eine ausgebildete Opernsängerin auf die Bühne, die nicht nur groß singt, sondern auch große Oper spielt. Herrlich dazu Katharina Marie Schubert, die verzweifelt versucht, gegen Torkels Opernstimme anzusingen.
„Dreigroschenoper“, ganz Brecht´sch und doch mit Mut zu Brüchen, aber etwas zu wenig Raum für das Stille und die bitteren Momente. Und weil Nunes wohl keinesfalls den moralischen Brecht herauskehren will, findet er letztlich auch das Ende nicht. Mackies letzter Song („Grabschrift“) hätte durchaus Potential zu einem starken Schluss gehabt. Doch so recht vertrauen wollte Nunes dem nicht. Er lässt also nicht nur den obligatorischen Brown als königlichen Boten auftreten, um Mackie zu begnadigen, sondern baut darum noch eine große Geschichte vom Pferd – im wahrsten Sinne des Wortes. Ein etwas unentschiedener Abschluss für einen sonst sehr entschiedenen Abend.
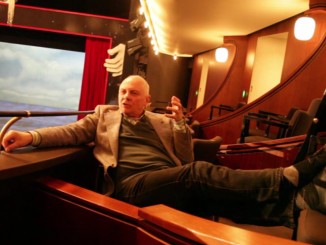

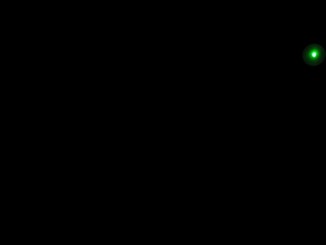
Hinterlasse jetzt einen Kommentar