Was für ein merkwürdiges altes Stück Theater: Ein unleidlicher Mensch mit genügend Macht und Geld sperrt ein Mädchen über Jahre ein und hält es von jedweden Umwelteinflüssen fern, um sich eine fügsame Ehefrau heranzuerziehen.
Solcherlei Experimente gibt es so einige im literarischen Fundus des 17. und 18. Jahrhundert, die Vorstellung, dass die Gesellschaft den Menschen in seiner moralischen und emotionalen Entwicklung präge, ist ihr so eigen wie kaum einer anderen Epoche.
Diesen protoaufklärerischen Versuchsaufbau, geschaffen, um hinter die Fassade menschlicher Regelhaftigkeit und Etikette zu blicken, findet man bei Marivaux (»Der Streit«) ebenso wie bei Molière, und selbst Lorenzo da Pontes so weit entwickeltes und oft verkanntes »Cosi«-Libretto fußt auf dieser Konstellation zwischen Spiel, dem Blick hinter die Fassade und dem wissenschaftlichen Experiment. Am Ende steht in der Regel der Sieg des Gefühls über das Theorem und die moralische Belehrung des Experimentators.
Dieser Stoff ist also auch hier in Molières »Schule der Frauen« zu finden, einer der ersten großen Erfolge des französischen Meisters aus dem Jahre 1663, der dann auch sogleich einen hübschen kleinen Kulturstreit auslöste. Das ist sehr lange 351 Jahre her und soll auch jetzt noch unser Interesse wecken.
Die emotionale Gesellschaftslehre dieser Zeit ist inzwischen einer bürgerlichen Vorstellung »romantischer« Liebe gewichen, die Experimente finden heutzutage anderweitig statt, nicht mehr in der Konstruktion von Liebes-Konstellationen. Was diese Geschichte heutzutage zu erzählen hat, könnte eine überaus spannende Fragestellung sein. Könnte.
Nun wäre aber der Regisseur Herbert Fritsch, Castorf-Schauspieler und theaterberühmter wilder Bühnenunterhalter, nicht Herbert Fritsch, wenn ihn diese Frage auch nur im geringsten interessieren würde. Zu sehen bekommt der geneigte Zuschauer nämlich eine wilde Hochgeschwindigkeits-Show mit fulminanter Schauspielerleistung, aller voran Joachim Meyerhoff, der just diesen unleidlichen Arnolphe gibt, der das Experiment verantwortet.
Dieser ist ein Schauspieler, der mit all seiner expressiven Kunstfertigkeit, brillant bis zur Schmerzgrenze und solistisch-egomanisch seinen Molière-Text über die Rampe kotzt, dass das Echo von den Logen widerhallt und merkwürdig synthetische Soundeffekte bildet. Und man lernt vor allem die unerbittliche Exaktheit der Komödie kennen, etwas, das dem vermeintlich so anarchischen Regisseur schwer entgegen kommen muss, denn das ist die andere, ungleich größere Erkenntnis des Abends.
Der Mann ist tatsächlich ein strukturaler Pedant und damit erstaunlicherweise mehr der kulturellen Disposition des Barocks verpflichtet als man zunächst annehmen möchte. Das äußert sich nicht nur in der Exaktheit dessen, was man gemeinhin so als »Timing« bezeichnet – dass das zu stimmen habe in der Komödie, ist eine Binse.
Es sind jedoch die streng choreographierten Auftritte, die genauen, geometrisch anmutenden Positionierungen der Figuren, das Spiel mit Raum und Tiefe, das opernhaft Rezitative, deren formale Gebundenheit einer Vorstellung barocker Lebensweise entgegenkommen können.
Diese Zeit, die sich in jeder Ausdrucksform der Struktur, dem »Stil«, verpflichtet fühlte, in ihrer alleuropäischen Verunsicherung durch das große Schlachten des frühen 17. Jahrhunderts, hangelt sich an der Form entlang und hält sich fest. Fugenprinzip, axialsymmetrische Gärten, Versmaße, all das sind die bewahrenden Elemente der Ausdruckskunst jener Epoche. Und die findet sich hier nun wieder in den struktiven und formalen Elementen dieser Bühnenschau des frühen 21. Jahrhunderts.
Die Dramaturgin und Fritsch Ko-Adjutorin Sabrina Zwach hat zudem eine biegsame, rhythmisch treibende Übersetzung geschaffen, die der Alleinunterhalter Meyerhoff mit Lust solange biegen darf, bis er auch der letzte Kalauer aus der molièrschen Urform gepresst wird. Es ist ein grosser Spaß und gewiss in seiner circensischen Clownerie eine der Schichten des molièrschen Theaters.
Vergessen kann man also das Ensemblespiel, das Gleichgewicht der Figuren und das Beziehungsgeflecht des Stückes. Wer da noch so auf der Bühne herumsteht, seien es Josef Ostendorf und Bettina Stucky als dekorativ-debil um die eigene Achse rotierendes Dienerpaar, der ewig schleichende Gegenspieler Horace (Bastian Reiber) oder gar das stets den Blick senkende Dispositionsopfer Agnés (Karoline Bär), tritt in der Hintergrund des großen Solos. Aber man sieht ihnen gerne zu, immerhin.
Fest verortet ist da im Übrigen keiner, ihre, auch Meyerhoffs, Bodenberührung ist immer fraglich, eine ständige Beweglichkeit haben sie. Auch das bestimmende Bühnenelement, ein monolithisches Holzhaus, scheint zu schweben vor dem Magrittschen Wolken-Rückenprospekt. Alles ohne Fundament, ohne Basis, Equilibristik alles das, siehe oben.
Die Ausstattung hingegen ergibt eine merkwürdige Mischung aus Rokoko, Barock und dem Klischee von all dem. Das grotesk überpuderte Gesicht gehört ebenso dazu wie das Cembalo-Accompagnato-Gezirpe. Diffus in irgendeine Vision des Rokoko geschubst, hie das »Panier«, der Reifrock, der Frauen, dort die nackenzopfige Perücke der Herren (Kostüme: Victoria Behr). Das ist zwar alles rund 100 Jahre nach Molière, das tut aber nichts zur Sache, da es offenbar ohnehin nur um den Eindruck einer »irgendwie« historisch verorteten Epoche geht.
Die spielt auch keine Rolle, denn eine Bezugnahme, eine Art der Reflexion des historischen Stoffes findet auch hier nicht statt. Die Geste des Dekors genügt vollauf. Dort sind wir wieder beim schon erwähnten barocken »Stil«, etwas, was sich derartig klischeeisiert in das kulturelle Gedächtnis gefräst hat, dass es offenbar auch hierfür taugt.
Theodor W. Adorno hatte Ende der sechziger Jahre in einem klugen Aufsatz vom »missbrauchten Barock« gesprochen und damit den dekorativen Gebrauch der barocken Strukturen durch die bürgerliche Gesellschaft stigmatisiert. Darüber könnte man auch hier nachdenken und sich die Frage danach stellen, ob hierin, im Rückgriff auf das rein Dekorative, nicht die wahre Spießigkeit des so avantgardistisch auftretenden Abends liegt. Demzufolge wäre ja auch die eingangs gestellte Frage nach dem inszenatorischen Interesse hinfällig – aber vergessen wir das, wirklich. Was für eine geile Show …

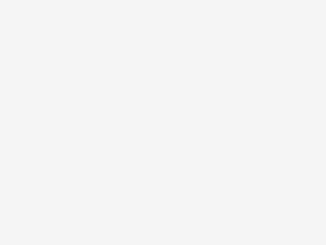

Hinterlasse jetzt einen Kommentar