
Martin Gore muss hinter der Bühne stehen, vielleicht ja auch Karl Bartos. Karl Bartos würde vielleicht dem Regisseur besser gefallen. Denn es klimpert der elektrisch zerberstende Krug immer wieder mal ins Stück, als sei’s ein Sample von Kraftwerk oder Depeche Mode.
Das Technische spielt eine ziemliche Rolle in Bastian Krafts Kleistbearbeitung vom »Zerbrochnen Krug«, das einzige Drama, das zu Lebzeiten des Dichters aufgeführt wurde und seinerzeit ziemlich durchfiel. Wie man munkelt, lag das an Goethes ziemlich konventioneller Aufführung am Weimarer Hoftheater. Konventionell möchte diese Inszenierung am Thalia aber auf gar keinen Fall sein.
Auch wenn es noch entspannt-konventionell beginnt. In einem schönen kleistschen Monolog vor dem Eisernen Vorhang, offenbar aus der nicht in den finalen Text eingegangen Phöbus-Fassung, erzählt Birte Schnöinks Eve erst einmal die Geschichte, um die es geht. Diese Exposition ist nicht unnötig, schließlich dauert der Abend nicht einmal zwei Stunden, ist also knapp gestrichen und schnell gespielt, da klärt sich besser vieles schon einmal im Voraus. Es ist ja auch kein Samstagabendkrimi.
Sobald sich der »Eiserne« dann hebt, ist es dann Schluss mit Monologkunst, die technikgeprägte Welt des Bastian Kraft beginnt stupend. Auf dem Operafolien-Prospekt in der Halbdistanz der Bühne sieht man große Köpfe, es sind die Gesichter von Philipp Hochmair (Adam) und Tilo Werner (Licht), beide haben jeweils eine dieser schicken HD-Kameras in der Hand und spielen den Anfangsdialog als Duell der Mienen im Close-up.
Das ist auf gar keinen Fall konventionell und der wie immer physisch sehr präsente Philipp Hochmair sollte aufpassen, nicht als ewiger Bocksfuß in die Geschichte seiner Thalia-Arbeit einzugehen – von seinem Mephisto-Charakter in Nicolas Stemanns langem Faust bis zum einigermaßen verschlagenen Dorfrichter Adam ist es nur ein kleiner Hinkeschritt. Aber er unterhält vortrefflich.
Die nächste Verwandlung steht an, der Horizont reißt auf, und hinter diesem kommt ein labiles Gebilde aus schwarzen Stahlprofilen zum Vorschein. 8 nach vorne offene Kammern sind in zwei Reihen aufgehängt, diese hängen wiederum beweglich an einem horizontalen Rahmen, die Rückwände sind wieder projektionsgeeignet bespannt. Das müssen sie auch, denn jede Box ist mit den schon bekannten Kameras ausgestattet. (Bühne: Peter Baur)
Ein Raster also, auch für die 8 Personen des Stückes, eine jede hat ihr eigenes Kästchen. Die Welt ist hier nicht festgefügt. Es wackelt.
Und dann geht es flott los, mit der allgemeinen Befragung der Zeugen und der Verhandlung, ein jeder in seiner Box. Hin und wieder wird eine bisschen zwischen den wackligen Kisten herumgeturnt, immer wieder mal das Videobild der jeweiligen Redner auf die Rückwände eingeblendet, ab und an überblendet man und macht Gegenschnitte, schließlich ist das Ensemble komplett verdrahtet. Der Krug-Sample strukturiert gelegentlich die Szenenwechsel und die Pointen sitzen ziemlich gut im Timing. Es ist amüsant.
Sandra Flubacher gibt eine ziemlich trocken-gewitzte Marthe Rull, spielen tut sie immer noch gern, das merkt man, auch wenn man sie nicht mehr ganz so oft auf dieser Bühne sieht. Und wenn dann alle reden, hintereinander, durcheinander, dann gibt es sie, diese Kleistsche Kakophonie des Missverstehens, die Auflösung von Worten in Leere, die Destruktion. Es wackelt, aber sehr selten.
Nun kann man sich natürlich auch fragen, was denn dieses ganze Video-Gezeige, die Close-ups, die Schattenrisse (die gibt es auch) erzählt, in der kleistschen Komödie. Man ist ja ganz schön nah dran an den Gesichtern, das Wackelbild zeigt die »Reality«-Ästhetik einer vermeintlichen Authentizität.
Denn es geht ja um die Wahrheit in diesem Stück. Vielleicht auch ein bisschen um Schuld. Und was könnte wahrhaftiger sein, als das unmittelbar in Großaufnahme Gezeigte, die Nähe zu Ausdruck und Pore?
Konsequenterweise wird die Scheinrealität des Videobildes genau dann abgeschaltet, als es an die schlussendliche Aufklärung des Sachverhaltes geht. Die Kammern sind abgehängt, alles und alle kulminieren in einer einzigen dieser Kisten, die eng wie ein Fahrstuhl sind.
Alle sind nah beieinander und, dann kommen wir zur Wahrheit, ohne mediale Nähe. Das ist eine mögliche Sicht auf die Dinge, wenngleich eine schlichte. Hier wackelt nichts mehr.
Zum Schluß kommt Philipp Hochmair im Halbdunkel noch einmal auf die Bühne, schwenkt einen weißen Porzellankrug. Er zerbirst unter Hammerschlägen. Ein wahrhaft unkonventionelles Ende. Es ist wirklich amüsant, sehr.


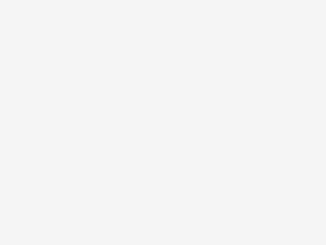
Hinterlasse jetzt einen Kommentar