
Hamburg hat inzwischen mehrere Literaturfestivals, das traditionsreichste sind die Vattenfall Lesetage, die in diesem Jahr zum 14. Mal stattfanden. Wir waren während der Festivalwoche an fast jedem Abend auf einer der 70 Veranstaltungen des Erwachsenenprogramms, um uns ein Bild des Programms zu machen und außerdem dem nachzuspüren, was die literaturferne Aufregungshaltung, die sich vor und während dieser Woche bei manchem breitmachte, zu bedeuten hatte. Von Vereinnahmung war da oft die Rede – um es vorwegzunehmen, indoktriniert hat überraschenderweise nicht die Energieindustrie, es sei denn, ein paar Banner mit Logos darauf zählen dazu. Ein langer Rückblick auf Haltungen und Texte.

Der Sommer war heiß, das Gras nicht nur grün und der Mann mit dem Hut und der Gitarre sang. Die Jungs waren in Vietnam und in Rußland war es kalt. Es mußte etwas geschehen, überall, so konnte es nicht weitergehen.
You’ll be drenched to the bone/If your time to you/Is worth savin‹/Then you better start swimmin‹/Or you’ll sink like a stone/For the times they are a‑changin‹.
Jahre später war der Winter verregnet, das Frühjahr ebenso. Der Mann mit dem Hut und der Gitarre sang wieder. In den Supermärkten standen Milchprodukte, die sich abwechselnd links und rechts drehen konnten. Die Jungs waren in Afghanistan und in den Wohnungen war es warm. Es mußte etwas geschehen, überall, so konnte es nicht weitergehen.
Diese Hoffnung schöpfte sicherlich auch der schwitzende Mann mit der unauffälligen Outdoorjacke in der kleinen Hotelbar. Angestrengt und sichtlich erregt krampfen seine Hände um ein Heftchen, das er anschließend zerreißt. Papierschnipsel rieseln zu Boden und dann folgt er seinen vier Mitstreitern und geht. Er geht schreiend.
Don’t stand in the doorway/Don’t block up the hall/For he that gets hurt/Will be he who has stalled
Eine Woche vorher bereits hatte sich eine Gruppe um den fast vergessenen Plauderer des deutschen Kulturfernsehens, Roger Willemsen, geschart, um endlich, im vierzehnten Jahr seines Bestehens, dieses Festival abzuschaffen und durch ein eigenes, natürlich viel Besseres zu ersetzen. Dazu bot man TV-Prominente einer Meinung auf.
Your old road is/Rapidly agin‹
Denn schließlich sei es doch vor allem wichtig, sich zu prüfen, vor welchen »Karren« man sich spannen ließe, so gab denn Willemsen schon einmal vorab im »Stern« bekannt. Man lese schließlich honorarfrei, nur für die gute Sache. Sagten alle übereinstimmend und kämpfen alle gegen die Vereinnahmung der Literatur durch den Kapitalismus, durch einen verachtungswürdigen Konzern. Das war das Thema dieses Festivals.
Come writers and critics/Who prophesize with your pen/And keep your eyes wide/The chance won’t come again
Essen müssen da anscheinend nur die, die auf der falschen Seite sind, eben woanders und nicht in Killesberg oder Schwabing oder Eppendorf den guten Barolo zu schätzen wissen. Und dort erinnert man sich gewiß gern an den 4. März 2003, als in der Hamburger Ausgabe der WELT zu lesen war, daß ein Mann »mit seinem »Karneval der Tiere« Heiteres von heute zwischen die schwere Kost« eines Festivalprogramms brachte. Das Honorar war vierstellig.
The slow one now/Will later be fast/As the present now/Will later be past
Es ist der Vorabend des Beginns des anderen Festivals, jenes, auf dem Männerhände mit Papierschnipseln werfen. An diesem Abend aber geschehen nicht nur Empörungen vor ausgesuchtem Publikum, es sprechen auch der Literaturkritiker Werner Fuld, Festival-Kuratorin Barbara Heine und der Autor Matthias Göritz in ihrem literarischen Salon über Denkverbote und Bücherverbrennungen, Zensur und die Macht des Geschriebenen. Es ist der Anfang eines Programms, dessen Themen sich über 10 Tage ineinanderfügen.
Werner Fulds Buch ist ein Kompendium der Geistesgeschichte ex negativo und verleitet in nachaufklärerischer Zeit gelegentlich zum Schmunzeln über die dunklen, vergangenen Zeiten. Es ist dieses aber das starre Grinsen des Schreckens, dabei vergesse man nicht, daß neben den Scheiterhaufen der brennenden Büche zuweilen auch die Autoren brannten, im Angesicht der Vernichtung ihrer Werke. Von anderen peinlichen Bestrafungen weiß Fuld auch zu berichten, die Geschichte der verbotenen Gedanken, die in Büchern niedergelegt wurden, ist voll davon. Aber geschadet hat es den Gedanken nicht, in der Regel war das verbotene Werk ein begehrtes Werk.
*
Einer der in Deutschland stets in die Ecke des spitzweghaft-pittoresken gestellten Autoren ist Charles Dickens. Der Rest des Bildungsbürgertums noch »A Christmas Carol« und dann noch den Titel »David Copperfield« – alle anderen denken dabei eher an einen Las Vegas-Entertainer, der einmal mit einem deutschen Modemädchen liiert gewesen sein soll. Aber im englischsprachigen Raum ist der Erzähler und Romancier Charles Dickens ein Name wie Donnerhall. Er fehlt hierzulande, der Name wie das Werk.
In diese Lücke stößt Hans-Dieter Gelferts Biographie des Engländers, die er zusammen mit Matthias Göritz vorstellt. Im Programmheft steht etwas von Moderation. Das ist falsch. Der Autor und Dichter Göritz ist ein ebenbürtiger Gesprächspartner des Berliner Literaturprofessors. Was wie ein akademischer Dialog daherkommen mag, dazu noch in einem holzgetäfelten Vortragsraum der Staats- und Universitätsbibliothek mit dem Charme einer Anna-Viebrock-Bühne, ist in Wahrheit ein munteres Gespräch zweier Beschlagener und Begeisterter – der Dichter, der immer wieder aus Werk und Literatur extemporiert und neue Bezüge schafft, und der Experte, der frei stehend im Saal erzählt und aus seinem Buch zitiert. Das ist keine Lesung, es geht nicht um das Buch, es geht um einen anderen Autor, dessen erzählerische Meisterschaft und sozial-dichten Genrebeschreibungen nicht nur die beiden faszinieren. Dieser Autor muß gelesen werden, auch in Deutschland.
*
Volker Hinz, einer der wichtigsten Photographen der alten Bunderepublik und vielgeehrt, hält Abstand. Ein paar Meter weiter sitzt ein kleiner Greis, mit einem auffallenden weißen Vollbart, einen braunroten Seidenschal locker über dem schwarzen Anzug gehängt. Er erzählt, seine Sprache ist Französisch, um ihn herum sitzen ein paar Menschen aus der Buch- und Verlagsszene, die ihm zuhören. Am nächsten Tag wird seine Tochter ein Buch vorstellen, das Buch seines Lebens.
Der alte Mann ist Adolfo Kaminsky, geboren 1925, das Buch heißt »Ein Fälscherleben«. Er hat ein Talent – das Talent, Papiere täuschend echt zu reproduzieren. Adolfo Kaminsky war der Meisterfälscher der Resistance, die Falschgeldfabrik der algerischen FLN, der Papierbeschaffer des Widerstands gegen fast alle Terrorregimes der Nachkriegszeit. Er verbrachte sein halbes Leben damit, mit diesen Papieren Menschen vor Verfolgung und Bedrohung zu retten, aber nahm nie Geld dafür.
Seine Tochter Sarah entdeckte seine Vergangenheit erst, als sie schon erwachsen war, und schrieb dieses Buch. Er sagt zu den Umsitzenden: »Vielleicht hilft ihr das Buch und meine Frau muß nicht mehr so viel arbeiten.« Ein paarmal nur löst die Kamera von Volker Hinz aus. Am nächsten Tag, auf der Veranstaltung, wird deutlich, daß es nur Momente sind, die ein Menschenleben in die eine oder andere Richtung bringen. Heldengeschichten entstehen nicht aus Absicht, sie passieren.
*
»Da habe ich Hoffnung“, meint der Autor und Journalist Martin Häussler. Er hat eine ganze Reihe von mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten zum Thema Angst befragt, herausgekommen sind erstaunliche Portraits zu einem außerordentlich deutschen Thema, das inzwischen sprichwörtlich ist für eine bestimmte Art der kollektiven Reaktion und für das Zaudern angesichts großer Themen.
Seine Hoffnung fußt, ein wenig diffus, auf dem Public-Viewing- und Atomausstiegsdeutschland, auf dem Quentchen Bewegung im gesellschaftlichen Gefüge, das er wahrzunehmen glaubt. So heißt denn sein Reportageband auch »Fürchtet Euch nicht!« Seine Hoffnung ist aller Ehren wert.
Glaubt man allerdings der Familientherapeutin Gabriele Baring, dann ist die Hoffnung noch weit und der Deutsche hat noch viel zu tun in der Aufarbeitung seiner persönlichen wie gesellschaftlichen Ängste. Sie gehörte zu den Interviewten des Häussler-Buches und dieses Gespräch gab den Anstoß zu ihrem Buch »Die geheimen Ängste der Deutschen«. Gabriele Baring ist eine vehemente Vertreterin ihrer Thesen und auch ihrer Therapierichtung.
Sie ist Schülerin des umstrittenen Bert Hellinger, dessen systemische Familienaufstellungen kritische Gegnerschaft hervorruft. Fragen danach beantwortet sie eher ausweichend, allerdings – ob nun das Gegenmodell »Tetralemmaarbeit« oder Hellingers »Systemische Familienaufstellung« – tut das der Grundthese ihres Buches keinen Abbruch.
Baring hat in ihrer Praxis mit vielen Angstphänomenen zu tun gehabt, und sie beschreibt in vielen Fallbeispielen, wie sie durch ihre Aufstellungsarbeit mehr und mehr an Überzeugung gewinnt, alle diese Ängste seien innerfamiliär übertragen worden.
Ihr Thema sind die Kriegsenkel, die dritte Generation derer, die ihr Leben unter dem Schatten beider Weltkriege, die von deutschem Boden ausgingen, gestalten müssen. Gabriele Baring sieht jene aktuellen Ängste, die in ihrer Arbeit behandelt werden, in der Tradition der traumatisierten Vorfahren – die Enkel müssen die Phobien der Kriegsgenerationen aufarbeiten.
Diese Idee ist an sich nicht neu, schon vor 6 Jahren beschäftigte sich die Kölner Journalistin mit den »Kriegskindern« und den Folgen für die Nachgeborenen. Neu ist vor allem Barings Analyse der gesellschaftlichen Situation, deren Grundlage all diese übertragenen Traumata sind – übertragene Ängste als lähmendes Moment der deutschen Gesellschaft. Möglicherweise hat sie damit eines der wichtigsten Sachbücher dieser Jahre geschrieben, allen dogmatischen Disputen zum Trotz.
*
Piraten, Piraten, Piraten. Natürlich denkt man bei einem, der mal Wired-Redakteur war, an die, die ein Dasein als Systemadministratoren haben und behaupten die Welt müsse transparent sein.
Und wenn dann der Roman auch noch eine Art Zukunftsvision mit digitaler Technik ist, noch mehr – Science-Fiction oder so, irgendwie cool, einer der über implantierte Kommunikationseinrichtungen schreibt. Doch Benjamin Stein ist kein Nerd und sein kleiner Roman »Replay“, eigentlich eher eine Erzählung, widersetzt sich hartnäckig den doofen Klischees, die man so gerne über Internet, Programmierer und all das diffuse Halbwissen über und in der »Netzwelt« verbreiten möchte.
Das Buch ist eine sprachlich ausgefeilte Versuchsanordnung zur Wirklichkeit und deren Wahrnehmung, Texte, die mit »Ich fürchte mich vor Erscheinungen, die ich nicht selbst erfunden habe« beginnen, und damit ihre Bedeutungs-Welt in einem Satz einkreisen, gehören nicht zu den schlechtesten. Und der Autor ist alles andere als eine Leitfigur des zur Zeit Modischen.
*
»Hi, i’m Bob.« Wer so hemdsärmelig von einem Nobelpreisträger begrüßt wird, weiß, es handelt sich um genau die Spezies eloquenter amerikanischer Wissenschaftler, die der ernstnehmende Deutsche nicht kennen mag. Robert B. Laughlin hat 1998 einen Nobelpreis für Physik bekommen und er hat ein Buch geschrieben, das sich mir den Energieproblemen der Zukunft beschäftigt.
Ein kurzer Abriß – in der englischsprachigen Wissenschaftswelt heißt so etwas »Abstract« – mit ein paar eingängigen Folien muß dem deutschen Publikum als Einführung in das Thema reichen, dann geht es in die vom Wissenschaftsjournalisten Gerald Trauvetter (SPIEGEL) betreute Diskussion mit dem Publikum.
Die ebenfalls geladenene Greenpeace-Gründerin, ehemalige niedersächsische Umweltministerin und jetzige Kreuzfahrer-Mitarbeiterin Monika Griefahn hatte urplötzlich und völlig überraschend erfahren, daß sie genau an diesem Abend an einer Preisverleihung teilnehmen müsse und konnte deshalb nicht an diesem Gespräch teilnehmen.
Wobei Diskussion eigentlich zu viel gesagt ist, in klassisch sokratischer Frage- und Antworttechnik nimmt »Bob« gerne einmal eine Frage vorweg und beantwortet sie gleich. Kurz und knapp geht der Physiker die bekannten Energieerzeugungsformen mit seinem deutschen Publikum durch. Im Grunde sei das Gros der Energiegewinnung ja nur »Feuer«, also die Umwandlung von einem in den anderen Aggregatzustand, meint er, nichts Neues seit der Steinzeit, auch die Atomenergie fiele darunter. Die mache im übrigen unangenehmen Müll, den man nicht wegbekomme, das andere »Zeug« CO².
Windenergie sei prima, aber wehen täte ja auch nicht immer und der Energiebedarf moderner Industriegesellschaften sei eben konstant. Ein paar zaghafte Einwürfe kommen aus dem Publikum, ein paar der nicht ganz so wütenden Energiekonzernkritiker haben sich offenbar in die Veranstaltung gewagt. Und was denn mit Gezeitenkraftwerken sei, fragt da einer.
Liegt ja auch nahe, schließlich ist das Wasser nie weit entfernt in Hamburg. Ja, das sei eine gute Idee, meint der Physiker. Man wisse ja, daß die Erdrotation von der beweglichen Masse des Wassers auf der Erde abhängig sei, verursacht durch die Anziehungskraft des Mondes. Entziehe man diese Energie, würde sich die Erdrotation einfach verlangsamen. Das sei physikalisches Gesetz. Sie scheint nicht so einfach zu sein, die Sache mit der Energie, da müssen wir uns wohl noch was einfallen lassen.
And the first one now/Will later be last/For the times they are a‑changin‹.
Und falls jemand fragt, ja, es ist Dylan.
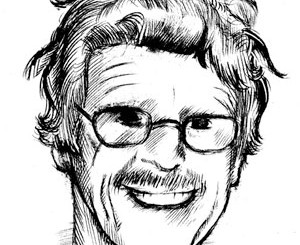


Hinterlasse jetzt einen Kommentar