
Es ist eine dieser total authentischen Geschichten, die uns so anrühren, ja, Gänsehautfeeling macht sich breit, wenn am Ende das Licht von unten kommt und Schauspieler in den Bühnenhimmel sterben. Es macht so richtig betroffen und das ist gut so. Denn die Zeiten waren so schlimm und es gab auch in diesen schlimmen Jahren Helden wie das Ehepaar Quangel/Hampel. Der kleine Mann hat nämlich das Herz auf dem rechten Fleck, er ist in die Zeiten geworfen und macht das Beste draus. Es gab sie tatsächlich, in der rauen Zeit, die Helden des Alltags, die bürgerlichen Widerständler, die kleinen Leute, die sich widersetzt haben vor dem großen braunen Ungeheuer. Wie schön, wie schauerlich, aber zum Glück ist das ja vorbei.
In all diesen grotesken, so verschleiernden und inzwischen volkstümlichen Euphemismen sind immanent an diesem Abend, der sich über vier Stunden erstreckt, im Hamburger Thalia-Theater, bei der theatralischen Umsetzung nach Hans Falladas Roman »Jeder stirbt für sich allein«.
Das erstreckt sich auch auf das Personal dieser Inszenierung, es wären da nämlich: das aufrechte Ehepaar Quangel (Thomas Niehaus und Oda Thormeyer), das, aus Schmerz über den im Krieg erschossenen Sohn, seinen eigenen Widerstand inszeniert, in dem es regimekritische Postkarten in Berliner Treppenhäusern deponiert. Immer fein, immer bescheiden und Seit an Seit schreitend.
Dann die Eckensteher und Kleinkriminellen, gezwungen durch wirtschaftliche Not, sich der Macht anzudienen. Und die Aufrechten, die nur ihren Job gut machen wollen, selbst »in schwierigen Zeiten«, aber doch nicht sauber bleiben können. Die kleine Kommunistin (Maja Schöne), die aufs Land, wo’s nicht so nazihaft zu sein scheint, flieht und sich dort den Sohn eines »gestrauchelten« Schergen aufnimmt. Und die alleinstehende Geschäftsfrau (Gabriela Maria Schmeide), die mit gutem Herzen den Großstadtganoven aufnimmt und doch enttäuscht wird. Das ist die Besetzung einer Dokusoap, alles Archetypen eines Histotainments, das jeden TV-Seher dieser zeitgenössischen Restauration umwabert, der Vergangenheitserklärer Guido Knopp trifft auf Dresdendiefluchtrommel.
Es ist zu befürchten, dass der Oberspielleiter des Hauses, Luk Perceval denkt, alles gut gemacht zu haben, oder, noch schlimmer, das alles nicht einmal gemerkt hat, in dem Bestreben »politisches«, gar wirklich richtiges, Theater zu machen, vielleicht sogar aufzuklären mit einem wichtigen Stoff. Herausgekommen ist leider die analytische Bequemlichkeit der Erhard-Zeit, die völlige Abwesenheit jedweder Deutingsdistanz.
Wie das aussieht? Da ist zunächst einmal eine dieser Bühnen (Annette Kurz), wie sie immer noch à la mode sind, leer, ein Rückenprospekt, der bis in den Schnürboden reicht, ein Tisch. Dieser Rückenprospekt ist bestückt mit Dingen des Alltags, eine stadtplanähnliche Struktur der applizierten Gegenstände wird deutlich. Ein bisschen angekokelt an einer Ecke, mittendrin kann man zwei Blechtrommeln erkennen, wir erkennen das Referenzsystem. Zwischen den Bildern hastet das Ensemble aneinander vorbei, die hälft von rechts, die hälfte von links aus der Gasse. Das ist Großstadtleben, Bewegung. Der Tisch ist wechselndes Requisit, von Berliner Wohnzimmer bis Plötzenseer Guillotine reicht das Spektrum seiner Bilder.
In der Exposition wird dann deutlich, wo es dramaturgisch hingehen soll. Leicht verschwommene V‑Effekte an der Rampe, das Reden über sich in der 3. Person schafft Distanz und suggeriert Realismus. Die Typologien der Figuren sind schnell klar dadurch, ebenso wie die emotionale Ausrichtung. Die Guten sind irgendwie geworfen in ihre Verhältnisse, die Bösen sind eben so.
Als die aufrechte Frau Quangel die alles auslösende Todesnachricht hört, zeigt sich in einem Mal die komplette Schwäche theatraler Überzeichnung, brechungslos rückt Oda Thormeyer ins Chargentum ein, ein Aufschrei, es fehlte nur noch das Raufen der Haare. Da will man ganz offensichtlich große Gefühle zeigen, sieht sehr deutlich, dass da eine Schauspielerin sich sehr bemüht, eine Emotion zuzubereiten, aber es funktioniert nicht.
Dass Oda Thormeyer das besser kann, ist ohne Frage. Dass sie das machen muss, ist um so schlimmer. Der Reigen der Platitüde geht munter weiter, wir haben Barbara Nüsse als SS-Knallcharge, die natürlich säuft, André Szymanski als aufrechten Polizisten, der dann am Ende, als er seinen Zeugen fängt, doch noch menschelt und sich erbarmt, sprich, den armen Tropf erschiesst, damit er nicht unschuldig in die Hände der noch finstereren Mächte fällt.
Es wird berlinert (Alexander Simon) – sympathischer Soundtrack zum willigen Vollstrecker –, und, a bisserl schmierig, gewienert bei der Vernehmung der armen Frau Quangel (ebd.). Österreich hat ja auch dazugehört, irgendwie.
Zum Schluss dann, nachdem die armen Arbeiterwiderstandskämpfer gen Himmel gefahren sind, fremdbestimmt sowieso, kommt in der Tat das ländliche Idyll, wir baumeln mit den Beinen auf dem Heuwagen und sind der Zukunft zugewandt. Pathetischer Realismus, wenn man so will.
Schon vor einiger Zeit hat sich das Haus eines dieser Klassiker angenommen, die aus demselben Brunnen schöpfen, Wolfgang Borcherts »Draussen vor der Tür«. Falladas Text wird offenbar im gleichen Geiste dramatisiert, Luk Perceval selbst und seine Dramaturgin Christina Bellingen zeichnen verantwortlich.
In seiner ursprünglichen Romanform ist das ein 704-seitiges Konvolut, ein Großwerk in der Charakterisierung des Einzelnen und der Machtmaschine. Das Vorhaben scheitert gänzlich an seiner Naivität, an dem Glauben, man müsse nur die Abziehbilder des Grausigen zeigen, dann würde schon alles klar. Leider wird dadurch eben nichts klar, überhaupt nichts.
Denn beide Texte, Borcherts Schulmeisterstück und diese Dramenfassung von Falladas Roman, sind Meisterstücke einer Kultur des kurzen Erinnerns, die die Ursachen ausblendet. Sie stellen fortwährend fest, sind Zustandsbeschreibungen, aber sie stellen niemals die Frage nach dem Warum. Sie sind Diskurse einer Behaglichkeit des Grauens, und damit sind sie nicht besser oder schlechter als etwa der populäre und triviale Thriller, ihr »thrill« ist die Betroffenheit einer saturierten Gesellschaft. Siehe oben.
Strapaziert ist es ja, das Brecht-Zitat, aber zuletzt bleiben eben doch alle Fragen offen, und die Erkenntnis hinkt sehr, sehr weit hinterher. Und wenn das Theater des Jahres 2012 nicht einmal mehr Fragen zu stellen vermag als Tatort-Regisseure wie Niki Stein (»Rommel«), dann hat es sich selbst erledigt. Dabei will es doch viel mehr sein.
Und das macht diesen Abend zum kompletten Ausfall, denn die Verhältnisse sind eben in der Tat nicht so, und vor allem nicht so einfach, wie uns das alles vorgegaukelt wird. Es ist eine Kapitulation vor dem Politischen unter Zuhilfenahme eines politischen Stoffes. Was ja kein Wunder ist, nach dem verlorenen Krieg.

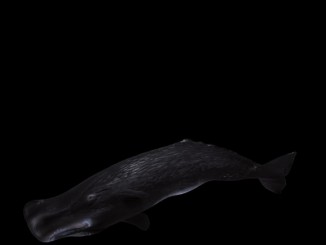


Wunderbarer Text. Darf ich das sagen, wo ich die Inszenierung gar nicht kenne?
Danke.
Man kann es nicht besser sagen! Kritisch, witzig und anspielungsreich.