
Aber den Zeus im Gesange des Sieges zu preisen,
Alles Denkens Frieden ist’s!
(Aischylos: Agamemnon)
Sie singen. Sie stimmen an den Paian, Siegesgesang zu Ehren Apolls, des Unheilabwehrers. Das Land ist Ödnis, die Szene um die wenigen Menschen hier in Theben ist leer und weit. Dimiter Gottschefs Theater braucht keinen Aufbau, braucht nur Raum, viel Raum. Dieses Theater ist sprachgreifend und choreographiert, vor allem auf den Schauspieler konzentriert. Inszenatorische Mätzchen gibt es hier keine, eine reine, klare Lehre steht hinter jenem Entwurf. Gottschefs Antigone zeigt die volle Stärke dieser höchst artifiziellen Kunst der Konzentration, aber auch ihre elendige Schwäche.
Ein grandioses Ensemble hat er sich der Altmeister da besetzt. Ziolkoswka, Beglau, Grawert, Niehaus, Geiße, Thormeyer – kunstreiche Artisten ihrer Zunft sind sie alle. Dimiter Gottscheff liebt dieses Ensemble, er hat sie geführt, in offenbar intensiver Körper- und Raumarbeit eingefügt in die knappe Geschichte des Mädchens Antigone, das sich Willkür und Räson nicht unterordnet. Antigone trauert, rotgerändert die Augen, in Gestus und Sprache »verrückt«, aus der Welt. Patrycia Ziolkoswka gibt dem eine durchaus groteske Form der körperlichen Entgrenzung – in eckiger Bewegung, verzerrter Hockhaltung, ist sie ein aus der Welt der Konformität taumelnder, arhythmischer Gegenpol zum Thebenstaat des bekränzten Orgeltraktierers Kreon. Ihre Sprache ist gleichartig verformt, disparat phrasiert, mechanisch. Kein Ausdruck mehr. Um so mehr das Bemühen aller Anderen, irgendeine Form dieses Ausdrucks zu finden, sei es singend, Räume suchend, Positionen einnehmend.
Überhaupt ist da so etwas wie Musik bei Gottscheff. Das meint nicht Sangesfetzen, nicht orgelbegleiteten Diskant und auch nicht die gelegentlichen Tubatöne Thomas Niehaus‹ Hämon, dem außer diesem Tongegrunze nicht mehr viel an Entäußerung geblieben ist.
Sedierung und Reduktion auch hier, Sprachlosigkeit. Vielmehr ist es die Gegenüberstellung der Disharmonie zwischen der nach außen gekehrten Welt des Thebanerstaats und der Stilisierung der Innenwelt Antigones. Am stärksten wird das im Abgesang Antigones, stampfend rhythmisch, gegenläufig besprochen – und immer wieder versuchen Thebens Stimmen, dirigiert vom Konzertmeister Kreon an seinem Instrument, all das in Harmonie zu ertränken. Gleich den Andrew-Sisters, mit der Sauce des vielstimmigen Wohlklangs um sich träufelnd, stehen Christina Geiße, Bibiana Beglau und Oda Thormeyer hinter den Standmikrofonen, für Antigone bleibt Charons Nachen auf dem trägen Flusse, Acheron. Hier ist ein kaltes Ende, das gleichkalte Stück geht weiter.
Und dann stockt nun auch der Fluss dessen, was einen an diesem Stück interessieren könnte. So aktiv all die Virtuosen da weiterhin agieren, immer wieder schweift der Blick nach oben, zu den Lichtbrücken. Dort bewegen sich seit dem Beginn, wohl nur aus dem Parkett voll einsichtig, wunderliche Maschinen, schwanengleich fabrizieren gelbe Kunststoffschläuche einen Regen aus rauchgefüllte Seifenblasen, die gemächlich zu Boden sinken und dort oder früher zerplatzen. Was bleibt, ist – trotz der knapp gestrichenen anderthalb Stunden, das, was man im Sport »Zeit schinden« nennen würde. Und gäbe es nicht die phänomenale Bibiana Beglau, die den großen Chorpart zum Ende allein bewältigt und dabei ihre ganze Kunst zeigen kann und auch muss, der Abend wäre theatralisch schon viel früher beendet gewesen. Und eines ist gewiss: Die Zeit dieses theoretisierenden Theaters ist ebenfalls beendet.

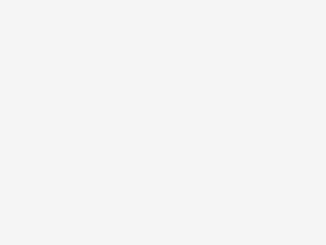
Hinterlasse jetzt einen Kommentar