Was um alles in der Welt mag eine ehrenwerte Theaterkritikerin bewegen, eine Debatte zu lancieren, die beinahe so alt ist wie das Theater selbst? Mit einem entzückend entrückten »man« beginnt die Klage der Enttäuschten, und das vorgetragene Lamento beschreibt den Verlust des Erfreulichen im aktuellen Theatergeschehen, vor allem dem Hamburgs. Nicht mehr linear, »mit traditionellen Mitteln« werde erzählt, nein, nicht auf das Drama werde sich konzentriert, sondern der mehr oder weniger diffuse Begriff der »Aufführung« würde zelebriert. Wie bekannt kommt einem dieser Gesang vor, als einst ein goldbeknöpfter Hamburger Bürgermeister einen mindestens ebenso so großen Verlust beklagte, ihm fehlte damals die »Wiedererkennbarkeit« der Klassiker. Die Causa war zu dieser Zeit Ernst Wendts »Minna von Barnhelm« am Deutschen Schauspielhaus, darüber sich heutzutage zu wundern, erscheint zutreffend.
Jedoch, der Klagegesang ist ähnlicher Natur, der Werteverfall wird beklagt, das Ehemalige, der Rückblick zum Ziel erhoben. Früher war eben alles besser, da war noch richtiges, »mehr« Theater, die Stücke verständlich, im Sinne des Textes, im Sinne des Autors und vor allem im Sinne des Zuschauers. All das ist bekannt, die Debatte war auch schon vor des Bürgermeisters Schelte da. Konnte diese bürgermeisterliche Intervention noch als das Urteil des bürgerlichen Laienzusehers abgetan werden, ist die Lage aber nun wohl anders.
Hier meldet sich jemand »vom Fach« zu Worte, eine Kritikerin, die die Höhen und Tiefen der Hamburger Theaterlandschaft über viele Jahre begleitet und kommentiert hat. Viel Erfahrung ist da im Spiel, das mag zu denken geben, und zumindest fühlen sich die beiden profiliertesten Intendanten der Stadt, Amelie Deuflhard und Joachim Lux, bemüßigt, dazu Stellung nehmen zu müssen. Deren Haltung ist klar, das »Non« ist laut und deutlich, und beide rechtfertigen ihre Arbeit mit dem großen Publikumszuspruch der jeweiligen Programme. Das müssen sie auch, der Vorwurf elitärer Kunstarbeit ist zeittypisch verpönt, vor Jahren, in Zeiten, als die Kunst und auch das Theater ein Ort der politischen Debatte war und die Grenzen der gesellschaftlichen Akzeptanz viel weiter gesteckt, da war das noch anders. Hier soll nach Meinung der Autorin die Debatte angesiedelt sein, in den Kriterien einer breiten Publikumsakzeptanz, die ja dem von ihr Beobachteten fehle. Das aber ist falsch.

Und wieder spielt die Angst des Bürgers eine Rolle. Der Verlust des Vertrauten, das Unbehagen, sich vom reproduzierbaren, vom Nachvollziehbaren lösen zu müssen, ist die Triebfeder dieses Gedankens. Ist es seit je der Text, der die Sicherheit verheißt – die zu bewahrende Keimzelle der Literatur, auch der dramatischen – da nachlesbar und nachzuverfolgen ist, ist es anscheinend nun die zeitgenössische Aufführungspraxis, die Unruhe generiert. Das Kollektiv der »mans« erschrickt vor der Kunstfertigkeit des Dargebotenen, dem Willen einer Annäherung an den Stoff, die nicht allein die Narration eines Dramas ist, sondern einen weiten assoziativen Raum absteckt.
Vermutlich geht diese Furcht vor der Vernichtung des erzählenden Dramas noch viel tiefer als die Furcht vor dem Verlust des Textes, gegen die man ja immerhin noch mit dem Bestreben nach dem Bewahren eines Werkes argumentieren kann. Wenn denn nun alles verloren ist, der Text, die Aufführung, das Drama an sich, in welcher Haltlosigkeit bewegt »man« sich als Zuschauer dann noch? Dann ist sie nur zur verständlich, sie Sehnsucht nach dem »echten« Theater, den »gehorsamen« Theaterdienern, die abhanden gekommen sind. Aber: »Es geht nicht darum, das Publikum mit transzendenter kosmischer Unruhe zu langweilen.«, so sagt der große Ängstliche des Theaters, Antonin Artaud. Er befreite sich und entwickelte Visionen.
Wo liegt also die Chance, wo liegt das theatrale Glück jenseits der Angst vor dem Unwägbaren, dem Ungewissen? Genau in der Idee, seine Gedanken um ein Thema »gefälligst selbst zu entwickeln« und ebendiese Visionen zu haben. Eine Kritik an der Schändung des Werkes durch einen autarken Leser, der sich durch seine Lektüre angeregt fühlt, seine Gedankenräume zu erweitern, würde uns in der Belletristik niemals einfallen. Warum dann im Theater?

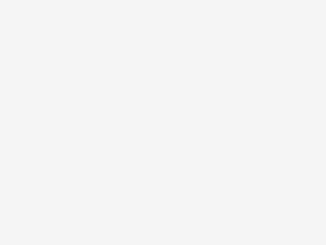
Ich glaube, zu wissen, was die »ehrenwerte Theaterkritikerin« bewogen haben könnte: die gute alte Saure-Gurken-Zeit. Für diese Annahme spricht, dass vergleichbare Debatten nahezu alljährlich im Sommer angestoßen werden, um ein paar Tage lang in den konservativen Feuilletons gepischt zu werden – und dann wirkungslos zu versanden. Weil sie von falschen Prämissen ausgehen, weil sie langweilig sind, weil sie Argumente benutzen, die schon vor Jahren keiner Diskussion standhielten.
Es ist müßig.
Das mag ja sein und ist sicher ein Sommerlochthema, das ist unbestritten. Aber das unkommentiert stehen lassen, im auflagenstärksten Printmedium der Stadt? Nein!