

Ein schwerer Text und beinahe eine unlösbare Aufgabe: Kleists Penthesilea auf einer Studiobühne. Unser Gastkolumnist Hans-Jürgen Benedict, seit Kurzem für Religion und Gesellschaft im HHF verantwortlich, war beeindruckt. Eine persönliche Betrachtung:
Heinrich von Kleists Penthesilea ist kaum spielbar. Ein ungeheuerliches Stück, das an die Abgründe von Liebe, Gewalt und Zerrissenheit rührt. Goethe war entsetzt von diesem Horrordrama, ganz das Gegenstück seiner »verflucht humanen« Iphigenie.
Kleists Drama ist ein Meisterwerk der Sprache. Augen versuchen zu erzählen, was sie sehen. Die atemlosen Verse schießen wie ein Katarakt dahin. Das Schlachtfeld des Stückes ist eigentlich die Sprache.
Eine derartige ebenso verletzlich-zärtliche wie aufbrausend-wütende Sprachgewaltmusik wie diese in der »Einrichtung« von Christina Ratka am Thalia in der Gaußstraße habe ich selten erlebt. Es ist die Macht des agonalen Kampfes, vor allem aber die des erotischen Begehrens, die als Unterdrückte sich in ungeheuerlichen Bildern und Vergleichen Bahn bricht und einen Sprachraum verschafft.
Die Sprache ist wie ein wilder Fluß, der auf seinen schäumenden Wellen einen tanzenden bekränzten Nachen mit irr handelnden Insassen vorantreibt. Noch heiter schön in der Schilderung des Rosenfests der Amazonen, erschüttert beim Sterben der Mutter, dann aufjauchzend-erwartungsvoll in der Begegnung mit dem »Lieben, Wilden, Süßen, Schrecklichen«, staunend-zärtlich in dem Ereiltwerden durch den Gott der Liebe, grausam kalt, gewalttätig im Aufbruch zum Kampf.
Patricia Ziolkowskas Penthesilea spricht das alles mit sich immer wieder steigernder Intensität, im Auf und Ab der sich widerstreitenden Gefühle, mit flammendem Blick, mit Geschrei und Geflüster. Die Musikalität der Kleistschen Verse blüht auf. Selbst dort,wo die schändliche Tötung und Abschlachtung des Achill detailliert an der Grenze zur Perversität berichtet wird.
Ruth Klüger hat in einem Artikel darauf hingewiesen, dass Penthesilea sich mit ihrem nekrophil-perversen Verhalten von den Prinzipien des Amazonenstaats entfernt, deswegen auch das Entsetzen ihrer Gefährtinnen über ihr Verhalten. Ihr aggressives Handeln: Hunde hetzen auf den Geliebten und ihn Zerreißen als koitalen Liebesakt, korrespondiert dem Achills, der auch in seiner Schilderung von Liebe die Hunde-Metapher verwendet. Beide begehen eine Tabu-Verletzung, Achill mit dem Schleifen des Leichnams Hektors, Penthesilea in ihrer tödlichen Liebes-Raserei.
Es ist ja merkwürdig – die Schauspielerin spielt eigentlich nicht, sie steht hinter einem Pult, auf dem der Text liegt, in der unwirtlich ausschauenden Gaußstraßen-Garage. Aber in dem Flusse ihrer Sprechgewalt, in dem ernsthaften Blick dieser großen Tragödin, in ihren unterstützenden Gesten geht einem die schreckliche Schönheit dieses Textes, dieses Liebes-Trauma aus ferner und doch so naher Zeit ganz anders auf, als wenn es ein durchgespieltes Stück mit Kostümen und Bühnenbild wäre.
Quälend-ungläubig Worte suchend für das Ungeheure, das sie getan: »Mit diesen kleinen Händen hätt ich ihn-? Und dieser Mund hier, der die Liebe schwellt. Ach zu ganz anderm Dienst gemacht, als ihn-Die hätten lustig stets einander helfend/Mund jetzt und Hand und Hand und wieder Mund-?«
Als sie begreift dass sie ihn zerrissen, nicht geküßt hat , spricht sie jene beängstigend naiven Zeilen, die ich, seit ich sie zum ersten mal gelesen, nicht vergessen kann: »So war es ein Versehen. Küsse, Bisse/das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt,/Kann schon das eine für das andre greifen.«
Dies nachgeholte Liebesbekenntnis führt zu einer fast pervers schönen Imagination – jemanden aus Liebe fressen: »Sieh her, als ich an deinem Halse hing/hab ichs wahrhaftig Wort für Wort getan./ Ich war nicht so verrückt als es wohl schien.« Schwärmer, der ich bin, behaupte ich: wenn der Geheimrat Goethe Patricia Ziolkowska als Penthesilea erlebt und gehört hätte, vielleicht hätte er sein negatives Urteil über das Stück revidiert.
Postskript: All sein Unglück und sein Glück, seine Verzweiflung und seine Hingabe hat der Dichter, dem nach eigener Aussage »auf Erden nicht zu helfen war«, in diese Figur gelegt. In den Sprachkaskaden gibt er der fatalen Liebeshemmung Ausdruck, die ihn und seine Heldin bedrängt. Als er in Henriette Vogel einen Menschen, eine Frau findet, die ihn zu verstehen scheint, ist es schon zu spät. Sie feiern ein letztes Mal das Leben und lassen es dann los im gemeinsamen Selbstmord.
In der Todeslitanei der beiden, erst 100 Jahre später aufgefunden, drücken sie das aus, was sie im Leben nicht leben konnten: »O Liebste, wie nenn ich dich.« Man hätte diesen Penthesilea-Abend sicherlich auch mit dieser Litanei schönster Liebesnamen im Angesicht des Todes beenden können: »Mein Heinrich, mein Süßtönender, mein Hyazinthenbeet, …« – »Mein Jettchen, mein Herzchen, mein Liebes, mein Lebenslicht, …« Hier, in dieser blumigen Litanei und dem darauf folgenden Selbstmord erfüllt sich, was jener ungeheure Satz aus Goethes Wahlverwandtschaften benennt: »Wie ein Stern, der vom Himmel fällt, fuhr die Hoffnung über ihre Häupter hinweg.«
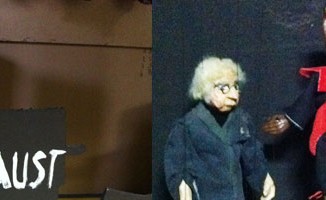

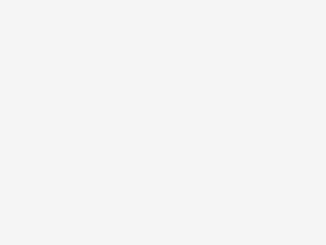
Hinterlasse jetzt einen Kommentar