
Michy Reincke, einer der rührigsten Pop-Musiker und Musikproduzenten in Hamburg, hat ein neues Album veröffentlich. Schaut man auf das Cover von »Sie haben den Falschen« [amazon Partnerlink], sieht man den Künstler mit tief ins Gesicht gezogenem Cowboyhut, vor vertrocknetem Bäumen und in typischer Westernpose. Wir trafen ihn im entsprechenden Ambiente, im Hamburger Museum für Völkerkunde, inmitten indianischer Tipis, amerikanischer Straßenkreuzer und bestickter Ledergewänder. Ein längeres Gespräch mit einem Mann, der sich offenbar Gedanken macht über die Welt und über seine Musik.
Pop, Camp, Radiomusik
HHF: Michy Reincke, du machst »deutschsprachige Popmusik für Erwachsene«, so in etwa steht es in den Pressetexten für dein neues Album. Was ist dein Begriff von Pop, was bedeutet es, dass du Pop-Musik machst?
Michy Reincke: Da ist, ehrlich gesagt, gar nicht meine Schublade. Das ist das, was allgemein wahrscheinlich für viele Arten von zeitgenössischer Musik gilt, das sie eben populär sind. Und die einen sind, wenn man nach der englischen Wortdefinition sieht, beliebter als andere und andere halt etwas weniger populär. Ich tu mich prinzipiell schwer mit Schubladen, aber es ist so, dass ich großen Wert auf meine inhaltliche Arbeit lege.
Als ich anfing, mich für populäre Musik zu interessieren, war es nichts ungewöhnliches, dass die Inhalte einen großen Stellenwert hatten. In den 60er und 70er Jahren hatten vor allem die Texte eine sehr große Relevanz in der sogenannten populären Musik, das haben sie heutzutage in diesem Maße nicht mehr. Es ist halt überdeutlich, dass in den Medien – in den privatwirtschaftlichen Medien sowieso, da ist das für mich auch keine große Überraschung – dass es dort auf Musik zurückgegriffen wird, die eher schlichtere Inhalte hat, die im besten Fall der Pose dient und des Reklameverkaufs.
Beim sogenannten öffentlich-rechtlichen Medium Radio/Fernsehen, das ja prinzipiell gemeinschaftseigen ist, mache ich mir dazu schon mehr Gedanken, was dahinter steht, dass man da etwas inhaltsinteressantere Popmusik zu unterbreiten nicht wirklich bereit ist. Es geht in erster Linie auch bei den gemeinschaftseigenen Formaten, wo Werbung verkauft wird, um die gleiche Programmatik wie bei den privatwirtschaftlichen Anbietern. Auch auf diesen Wellen geht es um eine Quotenbefriedigung, die für mich nicht mehr nachvollziehbar ist.
HHF: Schauen wir in der populären Musik tatsächlich auf die Inhalte oder auch auf die Triebfeder dessen, was wir als Pop bezeichnen? Es gibt ein Zitat von der Camp-Queen Kylie Minogue, sie hat gesagt, die Triebkraft des Pop sei Eskapismus, also etwas, was den Schein herstellt. Es geht nicht um Lösungen dabei. Kannst du das nachvollziehen und auch mit dem Begriff Eskapismus etwas anfangen?
Michy Reincke: Absolut. Prinzipiell kann ich auch mit dem Begriff Eskapismus in der Kultur was anfangen. Das ist aber nur eine Sichtweise und eine Art zu denken. Ich glaube, dass populäre Musik ein verstärktes Augenmerk auf Unterhaltung und Pose legt, sowieso. Aber, so wie ich Popmusik kennengelernt habe, hat sie auch immer einen inhaltlichen Nutzen gehabt. Einen Nutzen, wie ich Kultur seit der Aufklärung verstanden weiß, nämlich, dass es einen geistigen, einen seelischen und für mich auch darüber hinaus einen spirituellen Nutzen gibt, der in einem Kunstwerk vorhanden ist.
Nun ist nicht jede Form von populärer Musik ein Kunstwerk, aber in den meisten Fällen wird es von Künstlern hergestellt. Und wenn jetzt jemand behauptet, Bob Dylan ist jemand, der sich sehr mit der inhaltlichen Seite der populären Musik auseinandergesetzt und da sehr viel bewegt hat, dann ist das sicher so. Da ist dann aber auch nicht jeder Song eine politische Auseinandersetzung oder eine Kritik an der Gesellschaft, sondern da geht es auch manchmal um Sachen, wie »kannst du nähen, kannst du kochen«.
HHF: Das Zitat von Kylie Minogue geht übrigens noch weiter, sie sagt, die Kunst bestehe darin, diese Illusionen, die erzeugt werden, in Wahrheit zu verzaubern. Darin steckt eine Art Geniusbegriff, das heißt, die Leute werden durch den Künstler im Moment gepackt. Das Momentum ist vermutlich auch ein wesentlicher Bestandteil dessen, im Gegensatz zu sogenannter ernster Musik?
Michy Reincke: Menschen haben sich einst in Höhlen zusammengefunden und auf Knochenflöten gespielt. Andere haben irgendwelche Bisons an die Decke gemalt. Sie haben ein Feuer gemacht, wahrscheinlich getanzt und haben ein Ritual für sich gemacht. Letztendlich ist Kultur ein Spiegel in dem das Wesen Mensch sich erkennen kann und wo er sich korrespondierend mit diesem Ritual in der Welt verortet, definiert, differenziert.
Väter und Vorbilder: Dylan, Bowie, Prince
HHF: Bob Dylan, ist das ein Übervater, ein großes Vorbild, ene Grundidee, die in deinem Werk eine Rolle spielt?
Michy Reincke: Als ich anfing, mich mit Dylan zu beschäftigen war ich irgendwas zwischen 12 und 13, und der Initiationssong war (lacht) »Blowin in the Wind«, der ganz bestimmt nicht zu den stärksten Dylan-Songs zählt. Aber ich fand das halt mit meinen Möglichkeiten als 13/14-Jähriger – ein Song aus Fragen, wie ist das denn, wohin fliegt denn die Kanonenkugel und so (lacht) – eine interessante Form der Auseinandersetzung. Das regte mich an, einmal regte mich der coole Typ an. Ich würde gar nicht sagen, dass es ein Vater ist, sondern die Ziehmutter, das ist für mich meine Amme, meine erste Begegnung mit populärer Kultur.
HHF: Ist das heute noch so? Bist du ein »Dylanhead« und gehst auf Konzerte?
Michy Reincke: Ich bin ausgestiegen nach einem Konzert, da war ich 18, das war das erste Dylan-Konzert in der Dortmunder Westfalen-Halle. Es gab ein Album, das hieß »Street Legal«, das war das Album vor »Slow Train Coming« und da hat er sich sehr mit seiner spirituellen Herkunft und mit dem Christentum beschäftigt, da bin ich als 18-jähriger ausgestiegen.
Er verabschiedete sich beim Konzert, wir riefen »Zugabe, Zugabe« und ich verbrannte mir an einem Einwegfeuerzeug meinen rechten Daumen. Dylan kam auf die Bühne und verabschiedete sich in alle Richtungen mit dem Hitlergruß. Das ist halt jüdischer Humor in den späten 70er Jahren gewesen (lacht). Er wurde von dem Impresario Fritz Rau dann dazu verdonnert, im Jahr darauf auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg aufzutreten, weil er das getan hatte. Ich weiß nicht, ob er bekifft oder sonst irgendwie drauf war, aber ich empfand das als wirklich glühenden Liebhaber seiner Musik als Ohrfeige.
HHF: Man hört auf dem aktuellen Album eine große Stilvielfalt, es gibt dieses kleine Prince-Zitat, ist das ein Spiel mit einzelnen Stilen oder ist das eine Auseinandersetzung mit den jeweiligen Vorbildern?
Michy Reincke: Populäre Musik ist natürlich im weitesten Sinne eine ständige Auseinandersetzung mit dem, was schon da ist. Ich glaube, der Satz stammt von Paul McCartney, aus den 60ern: »Wir schreiben alle an einem großen Song«. Das kann man ja auch über die Musikerschaft hinaussehen, dass die ganze Menschheit an einem großen Lied mitschreibt und dass sie auch eigentlich bestimmt, in was für einer Gesellschaftsform und mit welchen Haltungen sie leben will.
Meine großen Vorbilder, die Menschen, die mich interessiert haben und mit denen ich mich viel beschäftigt habe, sind tatsächlich Dylan, Bowie und Prince. Das sind Sachen, die mir sehr nah sind. Trotzdem bevorzuge ich eine Art des formalen Ausdrucks, so wie er mir begegnet. Das ist eine sehr einfache Form von Rückung in den meisten Fällen, der ich versuche etwas abzugewinnen, da bin ich eher dylanesk. Ich wandere formal nicht durch die Tonarten, das ist dann eher selten.
Dann gibt es trotzdem so Sachen, auf dem neuen Album gibt es ein Lied »Hinter meinen Augen scheint die Sonne«. Das sind zwei Harmonien, das ist sehr »princesk«. Da versucht man wirklich den Beat laufen zu lassen und ein paar Bilder zu erzeugen und Linien zu kreieren. Das Lied besteht aus zwei Harmonien, und darüber baut sich halt was auf.
Ist es eine Hommage, ist es ein Zitat? Mir gefällt das in dem Moment. Das hat ja viel damit zu tun, was mir Freude bereitet. Ich gehe nicht durch ein Museum und klebe Zahlen von 1–10, Hitparadenplätze verteilend, an die Bilder, sondern ich lasse den gesamten Besuch auf mich wirken. So ist es auch der Besuch in der populären Musik, ich guck mir an, was gefällt mir, oder was haben andere da gemacht. Dann denke ich, das gefällt mir, das würde ich gern mal ausprobieren, nur auf einer oder zwei Harmonien ein Lied zu schreiben.
Geschichten
HHF: Das hat durchaus was Spielerisches in seiner Kombination von Elementen. Könntest du dir auch vorstellen, in anderen Genres, mit freieren Formen, etwas zu machen, z. B. mit den Leuten aus der sehr umtriebigen Hamburger Jazzszene? Du hast mit den Boxhorns, die auf deinem Album spielen, da ja schon ein Signal gesetzt, Mat Clasen ist ein guter Jazzsaxophonist. Kann das noch weitergehen?
Michy Reincke: Natürlich könnte das weitergehen. Eine künstlerische Entwicklung, wie ich sie auch für mich verstehe, hat natürlich immer etwas mit der Entwicklung der Form zu tun. Die Tatsache, die man sich bei so einer Frage bewusst machen muss: Ich betreib das nicht als Hobby oder bin Privatier oder der Sohn reicher Eltern, sondern das ist mein Beruf. Ich muss es irgendwie hinbekommen, dass mir eine bestimmte Anzahl von Menschen soweit folgt, dass ich davon leben kann. Sonst kann ich mir die dollsten Sachen ausdenken, sie sind für mich dann nicht herstellbar.
Daher ist also mein Hauptaugenmerk, wie ich Geschichten erzähle. Da ist das aktuelle Album, das Abschluss einer Trilogie ist, wo ich Geschichten erzählt habe, wie sie sonst, in der deutschsprachigen Popmusik sehr selten in dieser Qualität erzählt werden.
HHF: Würdest du da eher eine Nähe zum Chanson sehen, wo dem »Storytelling« eine wichtige Bedeutung zukommt?
Michy Reincke: Es werden ja Geschichten erzählt. Die Rolle des Geschichtenerzählers, desjenigen, der am Lagerfeuer sitzt und seine Geschichten erzählt, ist schon meine. Da ist es einigermaßen Wurst, ob der mit dem Musette-Akkordeon, mit einer elektrischen Gitarre oder mit einem vor sich hin wabernden Synthesizer seine Geschichten erzählt. Wenn man es hinbekommt, eine Klientel an Menschen um sich zu versammeln, die diesen Geschichten zuhören, dann ist das von Vorteil, wenn man das als Beruf betrachtet.
Ich bin sicher ein Freund von Jacques Brel, ich hab mich zwei Jahre lang mit Edith Piaf beschäftigt und auch mit der Musik ihrer Liebhaber, das sind mir alles Begriffe. Im deutschen ist das dann Klaus Hoffmann, der das eher macht. Ich seh mich eher in der erwachsenen deutschsprachigen Popmusik zuhause. Ich glaube, ich bin eine echte Alternative zu den sogenannten Epigonen (lacht) der deutschsprachigen Popmusik, die auch alle ihre Berechtigungskarte abgestempelt haben.
Ich denke allerdings, dass es in Deutschland diese große Verwechselung gibt, wie man Qualität definieren kann. Und da es seit 1993 auch im öffentlich-rechtlichen Radiosystem das sogenannte »formatierte« Radio gibt, sieht es eher düster aus. Qualität wird da ausschließlich über Quantitäten definiert und über Popularitäten. Das ist, wie wir alle wissen, manipulierbar. Der Geschmack und eine Mode unterliegt immer der äußeren Manipulation. Da ich unabhängig arbeite, und ein kleines unabhängiges Label habe, ist das für uns immer schwierig, sich da Gehör zu verschaffen. Wir sind dankbar für jede Form der Unterstützung. Es ist halt »erwachsene« Popmusik.
Kulturindustrie
HHF: Du förderst viele junge Künstler, Anna Depenbusch, Mia Diekow und viele andere, was ja doch noch ein bisschen an das Chansonthema anschließt, Anna Depenbusch, die ja auch mit exzellenten Texten arbeitet und ja auch ihren Weg gemacht hat. Gibt es da Verwandtschaften? Gibt es Rückkoppelungseffekte?
Michy Reincke: Verwandtschaften gibt es ganz bestimmt. Wir haben ja mit sowohl mit der Lauschlounge als auch mit dem Label Rintintin versucht, das Angebot zu erweitern. Das ist in der Form, wie es eigentlich wünschenswert gewesen wäre für eine funktionierende kulturelle Gemeinschaft, nicht passiert und auch abgeblockt worden ist. Da klingt jetzt so ein bisschen nach Bitternis und da ist auch eine gehörige Portion Wut dabei.
Es ist ja meine freien Berufswahl gewesen, das ist alles, wofür ich brenne und wofür ich mich engagiere, das ist meine freie Entscheidung. Wir haben 2005 mit Anna Depenbusch ein Riesenalbum mit »Ins Gesicht« veröffentlicht. Wir haben sehr große Schwierigkeiten gehabt, das an die Leute zu bringen. Letztendlich hat ja auch die Zeit gezeigt, dass es unheimlich viele Menschen gab, die sich dann auch für das erste Album interessiert haben. Ich habe fünf Jahre beim den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten geworben für diese großartige Künstlerin, und es blieben wirklich alle Türen verschlossen.
Es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo sie bei der Industrie veröffentlicht, gehen all diese Türen auf. Es ist dann ein großer Erfolg und für mich auch absolut verständlich und gegönnt und mit Freuden empfunden, nachvollziehbar vergönnt gewesen. Aber für uns, als diejenigen, die das unterstützen, über fünf Jahre, das sind die Gelder, die ich auf meinen Konzerten verdient habe, die ich in diese Produktion gesteckt habe und mich dann mit diesen merkwürdigen Formen des öffentlich-rechtlichen Systems auseinanderzusetzen, das hat mich, gelinde gesagt, frustriert.
HHF: Woran mag das gelegen haben?
Michy Reincke: Das ist ein Punkt, glaube ich, dass die Menschen im Kopf nicht frei sind. Das andere ist tatsächlich, dass sich die meisten in den entscheidenden Positionen darauf festgelegt haben, wenn das keine Quantität hat, dann kann das auch nichts sein. Das ist ja jetzt nicht so, dass alle alternativen und unabhängigen Labels Krachmusik mit verzerrten Gitarren machen, wo man die Hausfrauen nicht erschrecken darf, sondern es gibt sehr wohl sehr viele Anbieter die halt auch mainstreamige Musik machen.
Mir wurde z. B. noch 1996 wortwörtlich gesagt: »Michy, du kennst doch unser Format, das kann doch für dich nicht so schwierig sein, etwas in der Art herzustellen«. Wenn man dann »Musikdienstleister« ist, dann ist man bei solchen Herrschaften gut aufgehoben, wenn man das nicht möchte, hat man eben keine Chance.
HHF: Ist das heute noch so?
Michy Reincke: Das ist heute mehr denn je so.
HHF: Wird das aktuelle Album denn gespielt?
Michy Reincke: Nein.
Formate
HHF: Das heißt auch, dass »formatierbare« deutschsprachige Sänger eher durchgeschoben werden als solche, die nicht ganz dem formatierten Sound entsprechen?
Michy Reincke: Das hat, glaube ich, nichts mit dem formatierten Sound zu tun, ich glaube, dass meine Lieder wenigstens die formale Klasse eines Oerding-Songs auch halten können. Es geht darum, dass das Industrie ist und die Industrie drückt und die Industrie macht sich breit.
Es ist so, man kommt sich beim Hören dieser Sender wahlweise so vor, als sollte man jemand sein, der auf einem 80er Jahre Märchenfilm hängengeblieben ist oder jemand, der 13 oder 14 Jahre ist, dann gibt es dann Joris und Mark Forster und so weiter, das sind junge Musiker, die bei der Industrie sind. Da soll auch alles sein und ich möchte das auch nicht despektierlich behandeln, das ist Musik für junge Leute.
Ich glaube nur nicht daran, dass eine Gesellschaft, die sich seit mittlerweile zwei Jahrzehnten kulturell selbst für diese formatierten Radiosendungen des gemeinschaftseigenen Sendesystems so degeneriert, dass die in der Lage ist, gesellschaftliche Verwerfungen in irgend einer Weise auszuhalten und sich da zu orientieren. Wenn man einer Gesellschaft sagt, dass kulturelle Nonplusultra, was wir euch anzubieten haben, ist in diesen Verkaufslisten enthalten. Das »Beste von Heute« wird nach Verkaufslisten ermittelt.
Als ich 13, 14 war, hab ich Hitparade super gefunden, das hab ich mitgeschnitten auf dem Taperecorder. Mit 15, 16, 17 kommst du zu anderen Ergebnissen, was dir gefällt und was du für gute Musik hältst. Das ist nicht so, dass Hitparade komplett ausgeblendet ist, aber es hat niemals mehr in meinem weiteren Leben eine wirkliche Relevanz gehabt. Wenn eine Gesellschaft sich also dazu auffordert, nach Hitparaden zu funktionieren, dann hat sie für mich in ihrer sozialen Kompetenz und in ihrer geistigen Tragfähigkeit auch nur das Format eines 13-jährigen.
HHF: Das geht ja einher mit der Sehnsucht nach Rankings, die 10 besten Tipps usw. Wenn wir gesellschaftlich weiter denken, ist diese Sehnsucht nach Teilen der Verordnung nicht immer auch eine Form von Angstäußerung, einer Sehnsucht nach Sicherheit?
Michy Reincke: Absolut. Hilflosigkeit, der Traum nach vermeintlicher Sicherheit.
Amerika und die Heimat
HHF: Da kann man auch die Schleife zur Musik ziehen, die das ja auch bieten kann. Ist die Westernästhetik im Artwork gewollt? Man sieht dich als Cowboy, den »Lonesome Rider«, diese Assoziationsbilder ziehen sich durch, ein Teil des amerikanischen Traums ist damit verbunden, Begriffe wie Freiheit, Individualität spielen da eine Rolle. Inwieweit ist das das Thema des Albums?
Michy Reincke: Das ist nicht beabsichtigt, es ist gerade konträr. Die Worte Freiheit und Individualität habe ich, glaube ich, in meiner ganzen Textarbeit noch nie benutzt. Ich sprech schon mal von »frei sein« oder von »frei«. Diese Idee, wie sie der amerikanische Traum vorgaukelt, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
Die gestalterische Umsetzung dieses Albums, wie auch der Alben davor, die wie gesagt diese Trilogie bilden, zeichnet sich erstmal dadurch aus, dass es auf der Vorderseite der Cover weder einen Namen noch einen Titel gibt. Das ist eine Verweigerung, sich zur Marke zu stilisieren.
HHF: Ich glaube, das wiederzuerkennen, wenn du sagst, solche Begriffe tauchen nicht auf. Aber wenn man sich so etwas anhört wie das titelgebende Stück »Du hier so«, das fängt tatsächlich mit etwas Kapitalismuskritik an – Formulierungen wie »Matrix des Marktes« kommen da vor. Das ist sicher ein Gegenmodell zu diesem gerade wieder aktuellen »Great America«-Gedanken – aber es gibt durchaus eine Vision von Fremdbestimmtheit darin, die ja auch in anderen Texten wieder auftaucht.
Michy Reincke: Das ist es. Da gebe ich absolut Recht. Das Sich-falsch-Fühlen in der eigenen Existenz, sich als Fremder zu fühlen, da, wo man eigentlich zu Hause sein und seine Heimat haben sollte. Das ist mir in meiner Lebenszeit, und ich weiß nicht, ob ich da aufmerksamer bin als andere, oder ob mir einfach nur andere Sachen passiert sind als anderen Menschen, aber diesen Begriff von »hier bin ich zu Hause, das ist meine Heimat und das sind die Menschen, für die ich kämpfe und eintrete«, das hat sich wirklich immer mehr verkleinert.
Ich empfinde mich mit Beginn meines Lebens, pubertär und auch in meiner jugendlichen Entwicklung bis Ende 20, überhaupt nicht als Außenseiter. Mittlerweile sehe ich mich schon als Außenseiter, der entweder auf dem Ufo sitzt, sich kniend vor einer abwärts führenden Treppe von hinten ablichten lässt oder eben mit dem tief ins Gesicht gezogenen Hut, als ein Cowboy-Außenseiter. Da ist das schon so.
Es hat für mich weniger mit einem Aspekt von Freiheit und Individualität zu tun, sondern es ist die tatsächliche Unabhängigkeit in den Gedanken. Ich möchte mich nicht mehr vergiften und manipulieren lassen durch die Gedanken, die mich durch ein mediales System in erster Linie zu einem Konsumenten bzw. zu einer politischen Marionette degradieren. Da halte ich dagegen.
HHF: Also ein ganz freiheitlicher, liberaler Gedanke – beim Begriff Heimat, den du eben verwendet hast, was ist die persönliche Heimat für dich?
Michy Reincke: Das ist das engere Umfeld, das ist die Liebe, die ich zu den Menschen empfinde, mit denen ich mich gerne verabrede, die ich gerne sehe. Das ist Heimat. Ich bin aufgewachsen bei meiner Großmutter in Ahrensburg, 20 km nordöstlich von Hamburg, mein Vater ist zur See gefahren, meine Mutter hat beim Zahnarzt in Hamburg gearbeitet, die habe ich nur am Wochenende gesehen. Da wo meine Großmutter gelebt hat, den Ort gibt es noch, aber der sieht nicht mehr so aus. Das war am Ende einer Sackgasse, da war ein ganzer Birkenhain, da stehen jetzt irgendwelche Häuser. Es ist schwer zurückzukommen in diesen Teil der Heimat.
Ich hab versucht, das zu beschreiben in einem Lied auf dem Album, »Die Frau, in der die Welt verschwand«. Es ist so, dass man zu unterschiedlichen Zeiten in seinem Leben mit Menschen, mit denen man eng zusammen ist, mit seinen Freunden oder mit den Liebsten, mit denen man sich umgibt, ganz bestimmte Rituale hat, bestimmte Wege gemeinsam geht, sich zum Bowlen verabredet oder sich freitags immer dann und dann in der Kneipe trifft oder immer gern in »das« Restaurant essen geht.
Aber wenn diese Menschen nicht mehr da sind, oder wenn sie sich aus dem eigenen Leben verabschieden, ob es Freunde sind oder ob es die Frauen sind oder die Lebenspartner, dann verschwindet mit diesen Menschen tatsächlich auch all das. Man geht dann nochmal Jahre später in dieses eine Restaurant, da arbeiten dann aber auch nicht mehr dieselben Leute, es ist anders. Es ist so, als würde man denken, Mensch, diese Mathematikarbeit würde ich gerne noch mal schreiben, jetzt weiß ich, wie es geht (lacht), man kommt in die Schule, und die Leute sind nicht mehr da, um die es sich eigentlich dreht. Von daher ist für mich Heimat niemals ein Ort, sondern es ist das eigene Bewusstsein.
HHF: Zwischen den Texten im CD-Beiheft gibt es eine ganze Reihe eingeklinkter Zitate. Eines davon, auf einer Doppelseite zum Song »Noah«, ist ein Pessoa-Zitat, da geht es um die Destruktivität der menschlichen Zivilisation, das klingt nach einer gewissen Resigniertheit. Die zivilisatorische Gesellschaft ist etwas, das eher zerstörerisch ist, eine destruktive Kraft – ist es das, woraus das Werk schöpft?
Michy Reincke: (kurze Gedankenpause) Ich glaube, es ist unstrittig, wenn man sich auf das ganze dünne Eis der Begrifflichkeiten begibt, dass es Gut und Böse gibt, so schlicht das in irgendwelchen Religionsphilosophien dargestellt sein mag, es gibt Gut und es gibt Böse. Die größten Ungerechtigkeiten der Welt werden nicht von Säbelzahntigern oder von großen Bären am Menschen verübt, sondern von anderen Menschen.
Das heißt, es gibt eine große Ungerechtigkeit, die meistens von Angst und Gier von Wesen veranstaltet wird, die auf irgendeine Weise glauben, sich das erlauben zu können. Das ist das, was die Destruktivität in dieser Gesellschaft ist, das ist sie, seit der Mensch sesshaft ist. Ich weiß nicht, ob das noch gilt, aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass, bevor der Mensch sesshaft wurde, waren es eigentlich Matriarchate im menschlichen Zusammenleben, die sehr gut funktionierten.
Diese ganzen destruktiven Kräfte erscheinen erst, wo diese ganzen Jäger und Sammler sesshaft werden und Wertschöpfung betreiben, mit Getreideanbau und Viehzucht und es dann eine andere Gruppe gibt, die diese Menschen bejagt und ihnen das wegnimmt.
Kunst und Menschlichkeit
HHF: Ist die Kunst die Rettung daraus? Also doch Eskapismus?
Michy Reincke: Die Welt, in der ich mich wohlfühle, ist die Welt von Künstlern, die ihre Kunst nicht als Pose betrachten. Auch von Religionsstiftern, die das nicht im ihrer selbst willen getan haben, sondern die versucht haben zu werben für das, was im Menschen auch angelegt ist: Diese große Solidarität, so eine Barmherzigkeit, seine Möglichkeit, sich selbst bewusst zu werden.
Sich darüber auszutauschen, was den Menschen zum Menschen macht und was ihn daran hindert, zum Menschen zu werden. Dass er nicht zu seinem Wolf wird, wie es der englische Philosoph Thomas Hobbes gesagt hat. Das taucht bei den Römern zuerst auf, »memento mori«, das ist die Hybris der Imperatoren und der Menschen, die das damals dominiert haben. »Erinnere dich daran, dass du jetzt gerade dabei bist und dass du sterben wirst«
Du kommst nicht davon, du kannst Menschen unterdrücken, du kannst sie ausbluten lassen, du kannst Geld zählen, du kannst Leute verarschen, aber du wirst sterben. Was bedeutet es dann für dich? Was bedeutet es dann in dem Moment, wo dein letzter Eindruck ist, zu sagen, ich war der beste darin, Menschen zu verarschen? Der griechische Held ist der, der besonders gut Menschen ermorden und Ungerechtigkeiten begehen kann, diese Idee und Interpretation von Erfolg ist bis heute gültig.
HHF: Aber der Held leidet auch darunter, da ist ja in der griechischen Tragödie genau das, was deutlich gemacht werden soll. Medea frisst ihre eigenen Kinder, alle sind sie »geworfen« und entsprechend gezeichnet. Würdest du sagen, du bist im weitesten Sinne religiös?
Michy Reincke: Das glaube ich nicht, aber ich glaube, wie ich bereits angedeutet habe, dass wir vor 20, 30, 40.000 Jahren gemeinsam am Lagerfeuer gehockt haben, vielleicht gab es schon Sprache, jemand hat was erzählt und wenn nicht, gab´s irgendwelche Rituale. Man hat irgendwas gemacht mit den Knochen von Tieren, hat irgendwas gebaut und gebastelt und an die Wände gemalt. Vielleicht ist das auch Schule, etwas, um den Kindern zu sagen, wenn der Winter vorbei ist: Dann jagen wir diese Tiere und wir machen das folgendermaßen, die bewegen sich so und das sind unsere Speere, keine Ahnung.
Kultur ist für mich absolut unentwirrbar verknüpft mit Spiritualität. Ich bin jetzt kein Fan eines »Vereins« wie der Kirche und ich bin auch nicht überzeugt davon (lacht). Aber es gibt bei Dostojewski, in den Brüdern Karamasow, diese Geschichte vom Großinquisitor, die der eine Bruder geschrieben hat. Eine Geschichte im 16. Jahrhundert, Jesus taucht wieder auf, in Cordoba. Jesus sagt gar nichts, aber der Großinquisitor hält einen Monolog, warum es nicht geht, warum das so, wie es jetzt organisiert ist, mit der Kirche, schon der richtige Weg ist (lacht). Die anderen würden sowieso nicht verstehen, was mit dieser Ethik gemeint sei, und so wie sie das machen, haben sie das alle im Griff und so läuft’s auch.
Da ist Dostojewski eben sehr deutlich, wo die Schwierigkeit liegt, Spiritualität zu einem Dogma zu machen. Eine spirituelle Idee zu einem Dogma zu machen, gelingt nicht mal richtig im Buddhismus oder im Hinduismus, da gibt’s halt nur Ansätze.
HHF: Mir ist aufgefallen und da sind wir wieder bei schon erwähnten Befreiungsthema – was immer wieder in deinen Texten vorkommt, ist die Tanzmetapher. Das ist einerseits natürlich etwas sehr Musikalisches, aber es gibt so etwas wie »wir zertanzen die Fundamente« in diesem Album.
Michy Reincke: Ja diese Metapher, es gibt ein Zitat von Dylan, wie sehen sie sich selber, ja als Sing- and Danceman. Das ist im Grunde genommen das Bild, singend und tanzend durchs Leben zu gehen.
Im Innersten meines Wesens glaube ich daran. Ich habe meinen Zivildienst in einer Altenwohnanlage gemacht und ich habe alte Menschen sterben sehen als 19-Jähriger. Was die Quintessenz eines Lebens ist – da bin ich dort zum ersten Mal mit dieser Frage in Kontakt gekommen. Es gibt unterschiedliche Arten, sein Leben zu beschließen. Das ist tatsächlich so bis zu dem Augenblick, wo jemand sagt, so Frau Meier, noch drei Wochen, tut uns leid, das ist der Krebs, es geht immer weiter. In dem Moment sitzt die draußen auf dem Stuhl und guckt sich die Wolken an und hört den Vögeln zu und nimmt eigentlich wahr, worum es essentiell und substantiell geht. In »Sign O The Times« heißt es: »Man aint happy truly unless man truely dies«.
Und selbst wenn ihr Mann Leiter eines großen Wirtschaftsunternehmens gewesen wäre und ihr Leben ständig im Vergleich und im Wettbewerb und unter Konkurrenzdruck gewesen ist: In dem Moment wo sie weiß, dass sie sterben muss, weiß sie, das alles andere fauler Zauber und dummes Zeug ist. Das ist das, worauf ich in jeder dritten, vierten Zeile meiner Arbeit immer wieder gerne hinweise.
HHF: Das ist ja in gewissen Sinne eine barocke Lebenseinstellung, es erinnert vielleicht an Andreas Gryphius, wo Menschen unter dem Eindruck, was vorher war, kurz nach dem Ende des dreißigjährigen Krieges, ein sehr starkes Endlichkeitsbewusstsein hatten. Alles vergänglich, alles eitel – woher kommt, außer aus der Individualerfahrung, diese starke Konzentration auf die Augenblickswahrnehmung?
Michy Reincke: Ich hab einen sehr interessanten Konfirmationsunterricht in den frühen 70ern genossen. Da hat uns unser Pastor Dorn, von der Wandsbeker Christuskirche, bei unseren Freizeiten, am Schaalsee, in Gartow, so hektographierte Zettel gegeben das standen, so wie bei Bob Dylan (lacht), irgendwelche Fragen drauf.
Diese Auseinandersetzung in frühester Jugend mit diesen substantiellen Fragen, das kann natürlich auch zur Pose werden, und das kann natürlich auch eine Eitelkeit sein, man wird aber immer wieder darauf zurückgeworfen. Meine Mutter ist sehr jung verstorben, die war 17/18, als ich zur Welt kam und ist mit 48 gestorben, mein Vater ist auch nur Anfang 60 geworden, das waren immer Abschnitte in meinem Leben, wo ich selber Schwierigkeiten hatte, mich selber existentiell auf irgendwas zu konzentrieren.
Wie komme ich jetzt weiter durch, was kann ich machen? Reicht das? Mir ging es aufrichtig nie darum, reich und berühmt zu werden – es ging wirklich immer darum, Freude an den Sachen zu haben, die man tut. Natürlich auch darum, Ungerechtigkeiten zu benennen.
Ich mach das nicht, damit ich irgendwie ’nen roten Flitzer fahren oder mir einen Swimmingpool in meinen Vorgarten bauen kann. Ich mache das, weil ich tatsächlich auch eine Verantwortung spüre, für mich selber, für mein Umfeld, Situationen oder Voraussetzungen zu schaffen, wo man ein glückliches, selbstbestimmtes, einigermaßen unabhängiges Leben führen kann. Das wünsche ich mir eben auch für meine Freunde.
Zum Beispiel ist diese Verantwortung für die regionale Musikszene in der Hansestadt und in Norddeutschland, da sind das die grundvorrausetzenden Impulse, die mich das haben machen lassen. Ich wünsche mir, dass in dem Moment, in dem ich sterben werde, Frieden in diese große Balance meiner Gedanken einkehrt und mich nicht sprachlos zurück lässt. »Hätte ich das gewusst, hätte ich es ein bisschen anders gemacht«
Das geht vom Tod meiner Mutter aus, wo ich sehr intensiv spürte, die war gar nicht so sehr schockiert darüber, dass sie sterben musste, sondern dass das alles gewesen sein soll. Der Schmerz setzt sich dadurch zusammen, zu erkennen, die wichtigen Sachen habe ich nicht gemacht und ich bin mir dessen bewusst – ich hab die Dinge nicht erkannt. Da kann Spiritualität in jeder Form, natürlich auch in den konventionellen Formen, hilfreich sein. Es kann aber auch Möglichkeit sein, sein Leben in möglichst vielen Momenten kreativ zu verbringen.
Die Grundvoraussetzung für alles wird immer die Liebe sein, die Liebe zu seinem eigenen Leben, die Liebe zu den Menschen, die einen begleiten, und die Liebe zu den Dingen. Und deshalb ist das so.
HHF: Das ist ja ein beinahe neutestamentarischer Ansatz?
Michy Reincke: Es hat nichts mit der Kirche zu tun, und da ist Dostojewksi für mich auch wirklich ein großes Vorbild, der auch sagt, Jesus Christus bleibt trotzdem, trotz all dieses Idiotentums, ist er der Beste. Lass ihn nicht übers Wasser gegangen sein, lass ihn nicht auferstanden sein, er ist trotzdem einer besten von uns.
HHF: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Wir danken den Hamburger Museum für Völkerkunde für die bereitwillige Unterstützung bei der Ortswahl für dieses Interview.

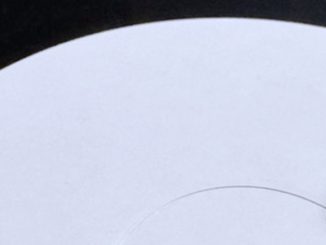

Hinterlasse jetzt einen Kommentar