
Die suhrkampsche Verlagspräsentation soll unzweifelhaft auf einen Großen hoffen lassen, einen jener Austro-Literaten, die die deutschsprachige Literatur so bereichert haben, einen neuen Thomas Bernhard – auch er ein Suhrkamp-Autor – vielleicht. Der junge Mann mit den feingezeichneten Zügen, der schmalen Brille und seiner Unrasiertheit hat dann auch eine jener Viten, die interessant erscheinen – nicht nur Schreiber ist er, sondern auch »Obertonsänger und Gelegenheitszauberer«. Das klingt sehr schön, ein wenig skurril, aber geht auch durch als weltenerfahrend speziell. Ein interessanter junger Autor also, zwei Romane hat er geschrieben, ein paar Preise hat er bereits bekommen, den größten nun mit dem Buchpreis der Leipziger Messe. Er ist vielleicht eine der Hoffnungen, auf die wir uns immer wieder einlassen müssen in jeder immer wieder neu Texte mahlenden Saison zwischen Frühjahrs- und Herbstprogrammen, zwischen Leipzig und Frankfurt, jährlich.
Schon der erste Einstieg in den Erzählungsband »Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes« kommt großmächtig daher, Clemens J. Setz landet einen gewaltigen Aufschlag, damit ist auch sofort klar, es handelt sich um »Literatur«! Sprachlich hoch angesetzt, bildgeschwängert, metaphernstark (»Clownsschminke, die man nicht mehr abbekommt …«), in einer gewaltigen satzbaulichen Arabeske, die über beinahe die ganze erste Seite geht, beginnt die Erzählung »Milchglas«. Die Innenschau eines Knabenlebens, unzweifelhaft pubertätsnah, ist die Folie für die minutiöse und dann auch gewandte und feingezeichnete Hinführung zu einem beiläufigen und wie selbstverständlich entstehenden Gewaltausbruch. Die Figur, der Erzähler ist eigentümlich sonderbar und ebenso eigentümlich vertraut. Wer dabei an »Törleß« denkt, ist nicht auf dem falschen Weg, eine Entwicklungsgeschichte mit einer nebensächlichen Verletzung der Konvention.
Gewalt, in alltäglicher Ausübung, in aller Beiläufigkeit – mitunter kommt schon das »ist doch gar nicht so schlimm« an den Leser heran – ist Setz‹ Thema, der Erzählungsband funktioniert durchgängig wie ein Variationenspiel über dieses Leitmotivs, der Zerstörung von Nähe und Intimität. Die Figuren sind hinreichend interessant, um nahbar zu scheinen, ihr Leben in der Regel jedoch langweilig genug, um eine Alltagsidentifikation zu bieten, selbst wenn sie sich in fernen Welten bewegen (»Charakter IV«). Die genau geplante Kunstfertigkeit des Autors Setz liegt vor allem darin, das immer wieder einsetzende Thema in Gleichgültigkeit aufgehen zu lassen, das »momentum« ist nie überraschend, sondern von einer eher selbstverständlichen Konsequenz geprägt.
Nicht immer funktionieren diese Projekte der aus der Normalität herauswachsenden Brutalität, es gibt unangenehme Ausrutscher im Konzept. Die durchweg pornographische Erzählung »Die Blitzableiterin« erstickt in ihren fast 50 Seiten im Bemühen, der sprachlichen Banalität ihres Genres zu entkommen und ihr einen entscheidenden und sich lösenden »Twist« zu geben.

Leider unterscheidet sich dieser Versuch nicht wesentlich von seinem Ursprung und ist damit komplett mißlungen.
Anders jedoch die Titelerzählung, bezeichnenderweise ist sie an das Ende dieses Bandes gestellt. Hier spielt Setz sein Experiment noch einmal synthetisch durch.
Zum ersten Mal wird die Gewalt als solche formuliert, das titelgebende »Mahlstädter Kind« ist eine Lehmskulptur, deren Kunstaffekt darin besteht, sie physisch zu verletzen, konkrete Gewalt auszuüben. Wieder einmal steigt die Erzählung in einen »Normalzustand« ein, ein junger Mann hütet die Wohnung einer Frau ein, die nächtens auszieht, auf diese Skulptur einzuschlagen. Natürlich ist er verliebt in diese Frau, der Abschiedsdialog zu Beginn, in all seiner Banalität, ist ein fein beobachtetes Stück verkniffener Kommunikation zweier ungleicher Partner in der Nähe.
Was folgt, ist der übliche, gleichwohl hoffnungslose, Versuch der Annäherung, der selbstredend und konsequent bis zur Erniedrigung des verhalten werbenden Liebhabers führt. Über all dem schwebt die Metapher der Entgrenzung durch die Ausübung von Schlägen gegen die Skulptur. Selbstverständlich scheitert der Werbungsversuch durch die fehlende Konsequenz des Mannes, sich gegen das »Kind« zu wenden. Ein geradezu klassischer Fall. Und hier stimmt dann auch die Mélange zwischen psychologischer Betrachtung und Bilderfindung, Skurrilität und spielerischer Konstruktion. Allein, das Ganze ist dennoch so indifferent in seiner Farbe, in seinem Gefühl, daß ein schaler Nachgeschmack, eine gewisse Unzufriedenheit bei der Lektüre zurückbleibt. Das ist weit entfernt von Bernhard, von dessen Unbedingheit und seiner Vehemenz. Es ist brav.
Clemens J. Setz: »Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes« (Amazon Partnerlink)
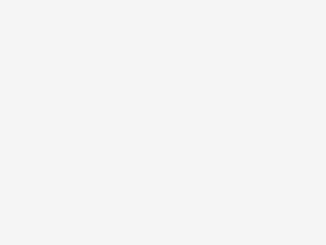

Hinterlasse jetzt einen Kommentar