Oben, am Geländer des Mittelrangs hängt eine weiße Neonskulptur. Es ist das »Auge Gottes«, das sich auf jeder Dollarnote findet. Das Ding leuchtet schon, bevor es losgeht, so richtig bekommt man es nicht mit, schließlich hat es das Gros der Zuschauer im Parkett im Rücken. Die Bühne ist leer, 4 Acrylhocker, eine weiße Decke, Flaschen, ein Brot, ein bisschen Bühnennebel steigt auf, über dem Geschehen kreist sehr langsam eine übermannsgroße Weltkugel. Wilfried Minks, der Roland Schimmelpfennigs jüngstes Stück »Peggy Pickit sieht das Gesicht Gottes« am Thalia Theater inszeniert hat, hat als Zadeks und Peter Steins Bühnenbilder begonnen, das haben wir nicht vergessen. Karg und artifiziell war einst sein Tasso-Raum, den er für Peter Stein schuf, das war 1968, der »Bremer Stil« damals ein Theateraufruhr. Der Mann hat Erfahrung.
Das sieht man allenthalben. Die vier Schauspieler (Oda Thormeyer, Gabriela Maria Schmeide, Matthias Leja, Tilo Werner) sind wirklich gute Leute, offenbar ebenso gut geführt. Die Geschichte ist einfach, zwei Paare, alles Mediziner, treffen sich nach vielen Jahren wieder, man hat sich lange nicht gesehen, das eine Paar war als – so heißt das ja in Deutschland – »Entwicklungshelfer« irgendwo in Afrika, Sahel, Kongo, wo auch immer. Ihre Freunde führen ein saturiertes, bürgerliches Leben, haben ein Kind. Es wird viel getrunken und geredet, die Beziehungen inner- und außerhalb geklärt, Konflikte hier und da, am Ende alles zerbrochen. Die Dialoge sind genau im Timing, fein gemacht und ausbalanciert. Das könnte also eines dieser Konversations- und Beziehungsdramen sein, wie sie in den achtziger Jahren ein Lars Norén schuf. Gelegentlich wird das Ganze ein wenig verfremdend unterbrochen, Kommentare gesprochen, Wiederholungen eingebaut, da bricht der »moderne Autor« Schimmelpfennig durch. Das ist alles sauber »vom Blatt« gespielt, der Thalia-Zuschauer goutiert das, sehr schön gemacht. Und, wie heißt sich das so schön? Gefälliger Applaus.
Doch, allein, hier irrt der Regisseur und auch der bereits sedierte Rezepient. Und zwar gewaltig. Schimmelpfennigs Text ist mitnichten ein Konversationsdrama, die Beziehungen und Beziehungsbrüche der Paare sind eben gerade nicht der Skopos dieses Stücks. Sie dienen vielmehr als eine Art Container, als Transportmittel für das Anliegen des Autors. Roland Schimmelpfennig hat sich der Nöte Afrikas angenommen, er ist ein moralischer Autor. Und er meint es ernst.
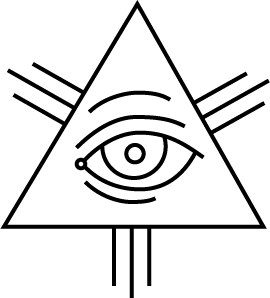
Eine der Schlüsselstellen in »Peggy Pickit« ist eine Art Gleichniserzählung gegen Ende des Stückes, ziemlich plakativ wird da von der gescheiterten Beziehung zwischen einem Europäer/Amerikaner und einer Afrikanerin geredet – ein Bild für die Unvereinbarkeit zweier Kulturkreise, für die Entfernung und Entfremdung zwischen Hilfswilligen und Hilfsopfern. Die Geschichte ist die einer Enttäuschung: »Sag bloß, du hast die Welt gerettet, nur um mich zu beeindrucken?« – »Das war sehr nett von dir …, aber ehrlich gesagt: Das wird nichts mit uns, ich habe schon einen anderen.« Das ist deutlich, ob das auf dem Theater wirklich Sinn macht, solche Appelle zu äußern, sei dahingestellt. Aber das ist eine gänzlich andere Debatte.
Ob das Stück gut funktioniert, das erzählt dieser Abend nicht. Der arme Tilo Werner steht an der Rampe und müht sich redlich, aber er kommt nicht vom Fleck, die Märchenerzählung (man könnte an dieser Stelle an den ebenso sozial engagierten Büchner denken, wenigstens ein bisschen) geht unter im Psycho-Parlando-Ton der ganzen Chose. Am Ende ist die Welt der Protagonisten kaputt, man müht sich, das zerschlagene Geschirr, respektive in diesem Fall die Requisiten, zwei Puppen, zu flicken. Da gibt es dann mal ein schönes Bild der Unfähigkeit der Westler, die Welt ist aus dem Leim und es hilft nur transparentes Klebeband. Aber das ist nicht einmal inszeniert, das steht wortwörtlich im Text. Vom Blatt eben.
Wie es hätte funktionieren können, bleibt eine Vermutung. Aber es ist vorstellbar, dass eine weitaus konsequentere Abstraktion – die sehr ausbalancierte Rhythmik des Textes weist schon darauf hin – der darin angelegten Laborkonstruktion der Sache gut getan hätte. Aber das ist wirklich nur eine Theorie. Es gibt also noch etwas zu tun für andere Inszenierungen.



Hinterlasse jetzt einen Kommentar