Der Abschluss eines solchen Festivals ist eine große Sache. Die Macher sind erschöpft, die Gäste wieder auf der Rückreise und man gönnt sich zum Schluß etwas Besonderes. Das Konzept der Abschlussveranstaltung der 2010er Lesetage war durch Eyjafjallajökull ein bißchen durcheinander geraten, das als rein französische Affaire geplante Konzert mit Naïm Amor und Dominique A musste umbesetzt werden, Naïm Amor saß nämlich in Tuscon fest und wartete bis zuletzt auf den Niedergang der Asche. Spontan eingesprungen war die schwedische Songwriterin Elin Ruth Sigvardsson, in ihrer Heimat ein ziemlicher Star. Unter den zur Gitarre singenden »Mädchen«, die derzeit die Musikszene überrollen, gehört sie sicherlich zu den besseren, ein bißchen Neo-Hippiefeeling, gepaart mit guten Songs sind ein guter Opener für so ein Programm. Und einen Bezug gab es ja doch, der Veranstalter Vattenfall kommt schließlich aus Schweden.
Hauptattraktion dieses wahrlich internationalen Abends war Dominique A, einer der Wegbereiter des Nouvelle Chanson in Frankreich. Bei Chanson denkt der durchschnittliche Kulturkonsument an exaltierte, dunkel gekleidete Herren und Damen, die sich die Seele aus dem Leib und dabei natürlich von »L’Amour« singen, gern zur Gitarre oder auch mit schnuckeligen kleinen Jazzbands begleitet. Ganz groß mit BigBand geht das auch. Frankreich hat da eine ruhmvolle Geschichte, von Charles Trénet bis hin zum deutschen Pilotenbarden Reinhard Mey (alias Frederik) reicht die Liste der international erfolgreichen Sänger. Als sich in den 90er Jahren junge Musiker ihrer französischen Musiktradion besannen und das Chanson auf neue, flinke Beine stellten, hielten sie sich durchaus an ihrer Tradition. Benjamin Biolay ist in vorderster Reihe zu nennen, ja, und auch Carla Bruni gehörte dazu. Dominique A ist sicherlich eine der sperrigsten Erscheinungen in dieser Nouvelle Vague des Liedgesangs und die Auswahl des hierzulande kaum bekannten Künstlers für den Abschlussabend ist ein Geschenk für dieses Festival. Getrieben ist der 1968 geborene von unbändigem Gestaltungswillen, sowohl textliche als auch musikalische Auseinandersetzung mit seinen Themen sind intensiv und lassen auch auf der Metaebene einiges vermuten. Sein an diesem Abend von der Hamburger Schauspielerin Laura de Weck klug strukturierend vorgetragenes Essay über seine Beziehung zur Musik verrät viel Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der Genese von Text und Klang. Nun kann man von einem norddeutschen Publikum kaum frankophone Neigung erwarten, vier exemplarisch vorgetragene Texte (alle eigens für den Abend übersetzt) aus dem Programm wiesen dann den Weg in die poetische Ausdruckswelt des Dominique A.:
Immortels
Ich habe dir nie gesagt
Daß wir unsterblich sind
Warum gehst du
Bevor ich’s dir verrat?
Hast du es schon gewusst?
Und hast du schon geahnt
Daß hinter unsren Säuferfratzen
Götter sich verbergen?
Das hat nichts mit lálá zu tun, sondern zeigt das Fortleben des französischen Pathos in der gesungenen Musik. Klingt das auf dem aktuellen Album La musique noch nach Pop, ist der Livekünstler Dominique A. weitaus verstörender. Bewußt hat er sich für ein Soloset entschieden, es genügt ihm die Gitarre. Wer nun glaubt, daß da einer vor sich hin klampft, um schön zu singen, ist damit auf dem komplett falschen Dampfer. Eine Batterie von Effektgeräten umrankt den Musiker, Kaskaden von Loops und Samples schaffen großflächige Soundteppiche, über denen die Gitarre die Qualen der Geschichten, die Dominique A. erzählen will, illustrieren. Das ist wohlüberlegt, konzipiert, bis hin zur Brüskierung eines Publikums, daß seine Ohren nicht durch den Wohlklang weich machen soll. Er sehnt sich nach Brüchen, nach Reibung, und das ist eine Herausforderung zu beiderseitigem Gewinn. Seine Stimme ist konservativ, warm und einschmeichelnd, wie er selbst sagt, »eine klassische Chansonstimme«. Musikalisch ist Dominique A. aber sicherlich näher an den Experimental-Poppern Daft Punk als an Jacques Brel. Daß dabei der mitgebrachte französische Tontechniker weit übers Ziel hinausschießt und den lustvollen Schmerz der Auseinandersetzung gelegentlich in Schmerzhaftigkeit kippen lässt, darüber muss man hinwegsehen.
Dieses literarische Konzert weist in die richtige Richtung. Textualität und Vermittlung waren ja im Vorfeld des Festivals anscheinend ein Thema, hier erschliesst sich in der interdisziplinären Auseinandersetzung eine andere Form der poetischen Vermittlung. Kein Effekt, kein Multimedia, sondern der Einblick in die ganzheitliche Beschäftigung eines Künstlers mit seinen Themen, eine Poetik der Verletzung, die die bigotte Kultiviertheit der Hochkultur, die vielerorts vorherrscht, bricht. Daß das nicht allen gefällt, ist klar. Kultur muss etwas wagen. Mehr davon!
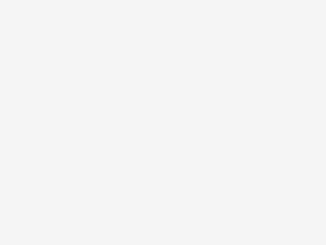

Hinterlasse jetzt einen Kommentar