Es ist nur ein kleiner Augenblick, ziemlich zu Ende dieses langen Stückes. Da antwortet der Schauspieler Charly Hübner in der Rolle des Dirigenten Karsten Schröder in Karin Beiers Fellini-Adaption »Schiff der Träume« auf die Frage, wer er denn eigentlich sei: »Der Dirigent.« Der Fragesteller fällt ihm ins Wort: »Stimmt nicht, du bist Schauspieler am Deutschen Schauspielhaus«. Ein Lacher.
Dieser kurze Moment, alsbald weggespielt vom Tempo der Inszenierung, ist elementar für das Verständnis dieses Theaterabends. Denn, so ist es eingeübt in der Tradition des deutschen Sprech-Theaters, der Zuschauer will Erkenntnisse gewinnen aus dem theatralischen Moment. Vor über 200 Jahren hielt der noch nicht 25-jährige Friedrich Schiller in Mannheim eine Vorlesung mit dem Titel »Was kann eine gute Schaubühne eigentlich wirken?«. Darin formuliert er die Grundlagen eines bürgerlichen Theaterverständnisses, einen Zusammenhalt von Vergnügen und Belehrung, ja, von moralischer Instanz. Der Text wurde später unter dem Titel »Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet« in sein Gesamtwerk aufgenommen.
 Der enthusiastische Vortrag, voller parabolischer Übertreibungen, im Geiste des Sturm und Drang gehalten, manifestiert einen Anspruch an die Bühne, dessen Kern tief in das Herz des Abonnentenpublikums eingedrungen ist. »Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staats eine Schule der praktischen Weißheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben«, heißt es da. Das wirkt bis heute nach, das Theater kann und soll uns Lösungen anbieten, wir wollen erkenntnisbeladen nach Hause gehen.
Der enthusiastische Vortrag, voller parabolischer Übertreibungen, im Geiste des Sturm und Drang gehalten, manifestiert einen Anspruch an die Bühne, dessen Kern tief in das Herz des Abonnentenpublikums eingedrungen ist. »Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staats eine Schule der praktischen Weißheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben«, heißt es da. Das wirkt bis heute nach, das Theater kann und soll uns Lösungen anbieten, wir wollen erkenntnisbeladen nach Hause gehen.
Was läge da näher, als einen Theaterabend, der sich mit der Konfrontation zweier unterschiedlicher Kulturen beschäftigt, als Modell zu nehmen für die drängenden Fragen der Zeit, für Migration und Fremdenbegegnung? Doch so simpel ist die Sache nicht, auch wenn man sich, ein wenig ennuiert, dieser Illusion nur zu leicht hingeben kann.
Karin Beier hat sich eine sonderbare Vorlage gesucht, Federico Fellinis doch einigermaßen in Vergessenheit geratenes Werk »E la nave va« aus dem Jahre 1984, im deutschen Verleih hieß dieser Film dann »Schiff der Träume«. Aus ihm schöpft sie den Grundplot, die Situation, den dramaturgischen Motor. Die Konstruktionen von Film und Bühnenumsetzung ähneln sich: Eine leicht manierierte Kulturgesellschaft von westeuropäischen Musikern, bei Fellini Künstler aus der Opernwelt des beginnenden 20. Jahrhunderts, bei Beier Mitglieder eines neutönenden Orchesters, versammeln sich auf einem Kreuzfahrtschiff um eine herausragende Figur aus ihrer Mitte auf dem Mittelmeer zu bestatten. Man bewegt sich hie wie da in den Zwängen einer Gruppensituation, in der elaborierten Künstlichkeit eines extrem kulturalisierten Miteinanders. Kurz bevor es zur feierlichen Bestattung kommt, trifft das Schiff auf Flüchtlinge eines anderen Kulturkreises, im Film sind es geflohene Serben, kurz nach dem Sarajevo-Attentat im Juni 1914, hier – natürlich und zeitgemäß – Afrikaner. Die »zivilisierte« Gesellschaft muss reagieren.
Diese Gesellschaft auf dem zeitgenössischen »Schiff der Träume« könnte zynischer kaum dargestellt sein. So verkörpern die Musiker des Orchesters, das sich bemüht, zur Seebestattung ihres Dirigenten ein Werk namens »Human Rights 4« aufzuführen, genau jenen Prototyp einer solipsistischen Kulturszene, die sich nur zu gerne um sich selbst kümmert. Vom Karrieristen (der Dirigenten-Stellvertreter) bis hin zur vegetarischen Weltverbesserin (Josefine Israel) ist beinahe jeder Typus vertreten. Natürlich ist das vortrefflich besetzt, erstaunlicherweise finden sich im Ensemble echte Musiker, herausragend als Instrumentalist ist dort vor allem Yorck Dippe, der die Baßklarinette zusammen mit dem kleinen, auf der Seitenbühne platzierten Orchester (Musikalische Leitung: Jörg Gollasch) vortrefflich zu traktieren weiß. Die Präsentation von »Human Rights 4« ist in der Tat eindrucksvoll bis hin zum Triangelspiel eines Charly Hübner, erfüllt aber vor allem das Klischee von »Zeitgenössischer Musik«, der ja ohnehin Körperlosigkeit und Kopflastigkeit angedichtet wird. Und klar ist auch der Name des Stückes, selbstverständlich beschäftigt sich diese Gesellschaft mit den großen Themen wie den Menschenrechten.
Die kleinen Querelen und Sinnsuchereien lassen einen bisweilen verzweifeln ob ihrer Belanglosigkeit, verstärkt wird dieser Effekt natürlich durch das berufsmäßig-professionell gut gelaunte Bordpersonal – sowohl die physisch so geschmeidige Großschauspielerin Lina Beckmann, als auch ihr männliches Pendant Jan-Peter Kampwirth als blondierter Chefsteward schaffen hier ordentliche Fallhöhe. Das ist auf seine Art zwar ungemein bösartig, aber in seiner zuweilen komischen Verzweiflung auf groteske Weise unterhaltsam.
Die Bühne ist à la mode – kahl, ein großes, bewegliches Versatzstück dient in seiner regalartigen Struktur als Raster für die Kabinenaufteilung des Schiffes, im Hintergrund sieht man die heutzutage schon obligaten Projektionen, mal den qualmenden Schornstein eines Dampfschiffes, mal abstrakte Muster, zum Schluss eine einsame Wasserwüste. Im Wesentlichen spielt sich das Geschehen im vorderen Drittel der Bühne ab.
Bis zum Eindringen der Fremden (Ibrahima Sanogo, Michael Sengazi, Sayouba Sigué – die auch im Stück ihre »natürlichen« Namen tragen) – ist also alles hysterisch normal, man fühlt sich zwar unwohl in seiner Welt, aber dennoch wird nichts wirklich in Frage gestellt. Die Reaktion der beisetzenden Kreuzfahrer auf die neuen »Gäste« und auch das Gezeigte folgt in logischer Konsequenz der Erwartung. Ihre Bestätigung holen sie sich aus der Erwartungshaltung, die im Gegensatz zu den Ängsten liegt, die das plötzliche Eindringen, die Infektion – zu diesem Begriff gibt es einen klugen Text des Berliner Philosophen Byung-Chul Han im Programmheft – mit dem Fremden mit sich bringt. Man sieht diese Konfrontation nämlich aus einer komplett idealisierten Perspektive, die das bestehende System nur bestätigen kann:
Der afrikanische Flüchtling tanzt gerne. Der afrikanische Flüchtling singt gerne. Der afrikanische Flüchtling trägt bunte Hosen. Der afrikanische Flüchtling hat einen trainierten Körper. Der afrikanische Flüchtling ist Akademiker. Der afrikanische Flüchtling hört knallharte Beats. Der afrikanische Flüchtling lässt sich nicht in einer Choreographie zwängen. Der afrikanische Flüchtling ist naturverbunden. Der afrikanische Flüchtling macht alles.
All das kann der Europäer nicht, der wünscht sich immer nur »Faust« und führt ein ungemein bewusstes Leben. Tiere isst er natürlich auch nicht. Aber er bringt auf jeden Fall Decken – »Sie brauchen Decken.«, bringt Unmengen von Kaffee in Thermoskannen, bringt Kleiderberge. Man erwartet dafür die »Integration«, und weder Zuschauer noch Bühnenpersonal werden enttäuscht. Und schließlich führt all das zur Identifikation mit dem ursprünglichen Aggressor, die Grenzen verschwimmen, der Gastgeber assimiliert sich, er tanzt mit den »edlen Wilden«, verkleidet sich in folkloristischen Gewändern – denn als solche erfüllen die Flüchlinge die Sehnsüchte der als inhaltlos und unauthentisch wahrgenommenen westlichen Welt.

In einer langen Passage wird wird der afrikanische Theoretiker Achille Mbembe an der Rampe verlesen, im Text – der selbstverständlich ebenfalls im Programmheft abgedruckt wird – wird der Mythos einer natürlicheren, ursprünglicheren Lebenswelt heraufbeschworen, was träfe den Nerv des entfremdeten westlichen Sinnsuchers eher, der schon in den 80er Jahren die »Weissagungen der Cree« an sein Auto pappte:
»Im alten Afrika war das manifeste Zeichen der Erscheinung, welche die Menschheit ist, das Samenkorn, das man im Boden vergräbt, das stirbt, wiedergeboren wird und Bäume, Früchte, das Leben hervorbringt. Um die Vermählung des Samenkorns mit dem Leben zu feiern, erfanden die alten Afrikaner Sprechen und Sprache, Objekte und Techniken, Zeremonien und Rituale, Kunstwerke wie auch soziale und politische Institutionen. Das Samenkorn sollte das Leben in einer zerbrechlichen und feindseligen Umgebung hervorbringen, in der die Menschheit Arbeit und Muße finden sollte, die sie aber auch schützen musste. (…) Die Natur verstand man als eigenständige Kraft. Man konnte sie nur im Einklang mit ihr selbst formen, umgestalten und kontrollieren. (…) Die Welt mit anderen Lebewesen teilen, das war die Schuld par excellence.«
Das kann man alles für direkt wahrhaftig nehmen, so wie die spontanen Szenenapplaudierer im Schauspielhaus, die offenbar genau die moralische Stellungnahme erwarten, die sie seit Friedrich Schiller gewohnt sind. Doch so einfach macht es sich die Inszenierung nicht, denn der theatralische Moment, das bloße Zeigen von Phänomenen, ist ihr immanent: Die afrikanischen Flüchtlingsdarsteller sind »echt«, radebrechen zwischen englisch, französisch und deutsch herum, sie stellen dem Publikum Fragen, die gar nicht beantwortet werden können und sind nicht nur in ihrer Rolle Inhaber all jener Kardinaltugenden des Idealmigranten, schließlich nehmen sie sogar an einem westeuropäischen Theaterprojekt teil – wie sagt Stewardess Lina Beckmann in der ins Showprogramm eingebundenen Abmoderation: »Und nächste Woche dann mit Orientalen«. Sie sind sowohl eine auf der Bühne bedingt austauschbare Vorstellung, eine Vision, als auch reale Personen mit eben solchen Geschichten. Wir erinnern uns – »du bist ein Schauspieler« – es ist nicht alles immer echt im Theater, und nicht immer ist die Botschaft eindeutig. Denn die Inszenierung bezieht hier nicht Stellung, sie verweist vor allem auf die Schwierigkeiten in dieser sogenannten Krise.
Die deutsche Bundeskanzlerin, Angela Merkel, hatte im Juni 2013 den viel und zu Unrecht kritisierten Begriff des »Neulands« geprägt, damals bezogen auf den Umgang mit dem Internet. Wie Recht sie damit hatte, zeigt sich auch heute immer wieder in der Hilflosigkeit, mit den Phänomenen dieses Übermediums umzugehen. Erst allmählich und sehr, sehr schleppend entwickelt sich eine Haltung zu all den Möglichkeiten, die sich dort anbieten
Hier nun geht es der Gesellschaft ähnlich, die Situation, auf andere Kulturen im eigenen Land eingehen zu müssen, ist für die aktuelle Generation neu. Die eilig und vor allem lautstark herbeigerufenen Antworten auf die als drängend empfundenen gesellschaftlichen Fragestellungen sind vermutlich keine Lösungen für die Ewigkeit. Man könnte all diese Reaktionen es als eine Art nationales Borderline-Phänomen verstehen, ähnlich wie bei dieser Form der Persönlichkeitsstörung wird auf unerwartete Konfliktsituationen mit extremen Reaktionen geantwortet.
Hier, im Theater der Karin Beier, hier ist es ebenfalls ein neues Land, das entdeckt werden muss, in all seinen Facetten, sowohl im Guten wie im Schlechten. Es sind viele Fragen offen, die nicht sofort beantwortet werden können. Und da taucht sie doch wieder auf, die moralische Anstalt Theater, anders zwar als von Schiller intendiert, aber doch präsent. Denn sie verweist nun vor allem auf die moralische Uneindeutigkeit der Situation und nicht auf das eindeutige Schiller’sche »Licht der Weisheit«, das auf das Volk »herunterströmt«. Ob die Inszenierung wirklich wegen dieser Ambivalenzen als eine der Inszenierungen des Jahres zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde?

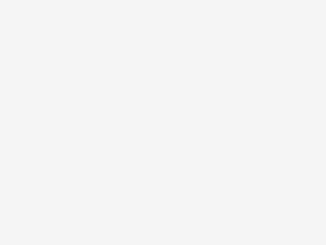

Hinterlasse jetzt einen Kommentar