
»Das können sie mal sehen, daß Deutschland hinter Dresden noch nicht zu Ende ist.« sagt der bärtige Turmwächter in Budyšin. Von Turm kann man bei gutem Wetter bis nach Polen sehen, oder auch nach Tschechien. Seine Stadt ist an diesem Ostersamstag gut besucht, die kleine Fußgängerzone zu Füßen des Bohata wěža ist gut gefüllt, die berühmte Neigung der Turmspitze bemerkt hier oben auf der Aussichtsplattform niemand. Die Strassenschilder sind hier zweisprachig, der Turm heißt deutsch Reichenturm und die Stadt Bautzen. An Ostern sind hier und in der ganzen Oberlausitz ringsherum viele Touristen. Bautzen ist das Zentrum der slawischen Minderheit der Sorben. Die kennt man außerhalb Sachsens fast nirgendwo, nicht einmal der jüngst veröffentlichte »Krabat«-Film verweist auf seine Herkunft als sorbische Volkslegende.
Ein paar Strassen weiter in der Altstadt findet man das sorbische Restaurant »Wjelbik«. Vor dem Eingang steht eine kleines Gehege mit drei schwarz-weissen Kaninchen, der erste Blick in den Innenraum offenbart ein dunkles Gewölbe mit bunten Glasfenstern und zum Teil trachtentragendes Personal. Das ist nicht unbedingt der Ort, an dem man kulinarische Finesse erwartet. Im Hauptraum ist alles belegt, der sogenannte Festsaal ist an diesem Tag für das Publikum freigegeben. Der allerdings erinnert mit seiner Holztäfelung an eine HO-Gaststätte oder an eine Bühnenausstattung von Anna Viebrock. Ein Blick in die Karte und auf die Tische ist in diesem Ambiente dann aber überraschend, der Speiseplan scheint ambitioniert und trotzdem bodenständig. Die sorbische Hochzeitssuppe schmeckt nach Fleischbrühe und nicht nach Wasser mit Aroma, die Salate, die auf den Tisch kommen, sind frisch, nicht aus dem Kühlschrank und bestehen nicht im wesentlichen aus gehacktem, gelblichen Eisbergsalat. Nach der Bestellung geht eine freundliche Dame in sorbischer Tracht von Tisch zu Tisch, begrüßt die Gäste auf Sorbisch und bietet hausgebackenes Brot und Salz an. Das mutet folkloristisch und befremdlich an, ist aber wohlmeinend und stimmt erwartungsfroh. Die Wartezeit ist nicht allzulang, das Sorbische Hochzeitsessen (Ochsenfilet mit Meerettich mit Brot und Gemüse) zart und gut abgestimmt. Ebenso gelungen sind die etwas blumig benannten Fünf Lausitzer Köstlichkeiten:
»Frühling in Bautzen«, gebeizter Karpfenschinken, gebackener Ziegenkäse, Entenbrust, Karpfenmousse und ein Wachtel-Spiegel-Ei »an« Salat. Leider kommt der Speisekartenpoet nicht um das etwas ältliche »an« in der Beschreibung herum, das tut dem ganzen aber keinen Abbruch. Der Karpfenschinken ist leicht und hat nichts von dem leicht muffigen Hautgout, der diesem gründelnden Schlammfisch sonst anhaften kann, die Entenbrust auf den Punkt und über den Salat ist oben schon geschrieben worden. Das hat alles nichts von tümelnder Küche, sondern ist modern mit regionalen Bezügen gemacht. Ein Wort muss noch über das hiesige Bier verloren werden, ein leichtes Helles wird hier serviert, schlank und erdig im Geschmack. Die Preise sind moderat, und das Mittagsessen damit vollends gelungen.
Am Ostersonntag reiten die sorbischen Männer in Gehrock und Zylinder auf gut gekämmten Pferden, das Zaumzeug mit Silber und Muscheln geschmückt, über die Felder. Das ist der Grund für den touristischen Andrang in der Region. Die Crostwitzer Reiter reiten nach Panschwitz-Kuckau. Die Panschwitz-Kuckauer reiten in die Gegenrichtung. Die ersten Reiter eines jeden Zuges tragen Banner, geschmückt mit dem Osterlamm und sie singen. Im Klosterhof des Klosters Marienstern hallt der Gesang sorbischer Choräle von den umstehenden Gebäuden wieder, die Reiter aus Crostwitz sind erschöpft, schließlich sind sie schon seit einigen Stunden im Sattel. Unter den Zylindern sieht man ernste Gesichter, aber keinesweg nur alte Mienen. Es reiten ganze Generationen, Enkel mit ihren Großvätern, Väter mit ihren Söhnen. Ein Piercing blitzt hie und da auf, ein Hipsterbart ist unter dem Zylinder zu sehen, eigentümlich verfremdet durch die Tracht. Es sind keine weltabgewandten Sektierer, die diesen alten Brauch pflegen. Unbekannt klingen auch die bekannten Kirchenlieder durch die fremde sorbische Sprache, auch säkularisierte Folklore-Touristen ergreift dieser andächtige Moment, wenn über 300 Reiter den Klosterhof dreimal unmkreisen.
Dabei ist die Sache nicht trivial, es handelt sich keineswegs um einen Trachtenverein, der irgendein Brauchtum pflegt. Für die Sorben der katholischen Oberlausitz ist das praktizierende Glaubensausübung, und, schaut man auf die Geschichte dieses Volkes, wohl auch eine wichtige Identitätsstiftung. Natürlich liegt die Vermutung nahe, daß der Ursprung der kurzen Reisen von eine Ort zum Nachbarort eine heidnische Feldweihe ist. Verkündet wird aber vor dem Beginn der jeweiligen Ritte der Segen der örtlichen Priester und der Auftrag, die österliche Botschaft der Auferstehung und Erlösung über die Felder zu tragen. Und das haben die Sorben immer getan, so berichten die älteren Reiter, auch in schweren Zeiten und auch durch Kriege hindurch. Die Lausitz ist ein sogenanntes strukturschwaches Gebiet, die Arbeitslosenquote gehört zu den höchsten im Bundesgebiet. Früher war hier ein Zentrum der Textilindustrie, die fast völlig verschwunden ist. Aber auch früher war es für die anderssprachigen sorbischen Bauern nicht leicht, in der Gesellschaft der »Deutschen« Fuß zu fassen. Noch heute wird Sorbisch vorwiegend in der Region gesprochen. Der Stachel sitzt wohl tief und ein enger Zusammenschluß zwischen den Gedrückten hat sicherlich zur Konstanz solcher alleinstellenden Rituale beigetragen. Eine Sorbin der jüngeren Generation, antwortet auf die Frage, warum ein aus der DDR geflohener Verwandter seine Muttersprache nicht mehr spreche, lapidar: »Vielleicht hat er sich einfach geschämt.«
Links:
Ein erster Eindruck zur sorbischen Geschichte bei Wikipedia
Sorbische Literatur im Domowina-Verlag, Bautzen
Offizielle Seite der Region Oberlausitz




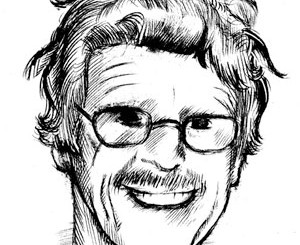
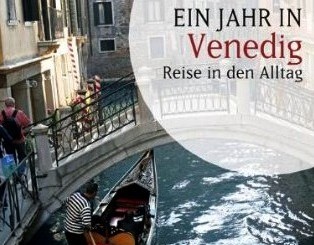
…und ein Blog aus der Lausitz: http://www.kostblog.de