
Der Pole ist faul. Der Pole klaut deutsche Autos und säuft wie ein Loch, vorwiegend Vodka mit Gras darin. Der Pole hat den Deutschen Schlesien weggenommen und Breslau, die Hauptstadt des deutschen Tischlerhandwerks. Und er trägt schrecklich unmoderne Oberlippenbärte wie dieser »Lech Wallassa«. Außerdem ist er katholisch, und das nicht zu knapp. Er mag seinen Papst, der schon tot ist; den deutschen Papst mag er weniger. Der Pole mag die Deutschen nur, wenn sie Geld ins Land bringen und wenn er deutsche Häuser restaurieren darf. Und in einem Polenstädtchen, da wohnte einst ein Mädchen.
Wenn der Pole feiert, dann mit dem besagten Wodka, von dem trinkt er dann viel, und dann sowieso in schauderhaft postkommunistischen Gemeindezentren, mit Resopaltischen und kaltem Neonlicht. Das Papstbild hängt an der Wand und die Mutter Maria ist immer in irgendeiner Ecke.
Das mit dem Neonlicht haben die Lichttechniker des Deutschen Schauspielhauses in ihrer Kantine ganz hübsch hinbekommen, der Rest der Ausstattung stimmt auch. Auf den Tischen stehen Bierpullen deutscher (»Beck’s«) und polnischer Herkunft (»Żywiec«), hineingesteckt sind Fähnchen mit der Aufschrift »Willkommen zum Deutsch-Polnischen Kulturfest«. Irgendwann ist da auch ein Typ namens Adom (Janning Kahnert), und er trägt tatsächlich einen dieser schrecklichen Oberlippenbärte und eine Kunstlederaktentasche, deswegen ist er wohl auch zweifelsfrei ein Pole.
An den langen Tischen, auf denen neben den Bierflaschen kleine Würstchen und saure Gurken angerichtet sind, sitzen sie, die Deutschen und schauen leicht betreten in Reih und Glied geradeaus, wo so was wie die Bühne zu vermuten sein könnte, da steht ein Klavier und ein Stuhl mit einem Akkordeon darauf. Feiern kann er ja, der Pole.
Der nun fängt einfach an zu reden. Der Oberlippenbartträger mit der schlecht sitzenden Jeans und der Kunstlederaktentasche sitzt hinten am Lichtpult und spricht einfach so drauflos. Diese hemmungslosen Drauflosredner gibt es ja schon mal, und dann schaut man so ein bisschen hin und ein bisschen wieder weg. Grenzverletzung ist das, und obwohl ja jeder weiß, daß irgendwann eine »Aufführung« beginnt, schauen alle etwas betreten daher und auch schnell wieder geradeaus. Wird schon gleich losgehen mit dem Theater. Doch der Redner hört nicht auf, er wird lauter und, schlimmer noch, er setzt sich mitten zwischen die Deutschen und spricht sie sogar an. Etwas verlegen antwortet eine junge Frau, der Bärtige neben ihr tut amüsiert. Alles schaut hin und weg.
Solche Theaterentwürfe sind nicht neu. Der linke brasilianische Theatermacher Augusto Boal prägte in den Sechzigern den Begriff des »Unsichtbaren Theaters«, Spielsituationen, die sich aus der Alltagsszenerie entwickeln und die in den politischeren Zeiten, 20 Jahre nach dem Kriegsende vor allem soziale Impulse setzen sollten. Das ist heute nicht mehr so, aber die Methodik ist die gleiche, Aufmerksamkeit zu erregen durch die Verletzung des kulturbedingten Nahraums, Deutlichmachung durch Konfrontation mit der ungewohnten Nähe des Fremden. Heute heißt das Wort der neuen Berliner Kurzbartträger dafür »Fremdscham«. Doch auch diese Inszenierung ist politisch.
Je länger Adom redet, desto mehr wird der Schauspielhauskeller zu einem Labor der Kontaktaufnahme. Die Geschichte ist ein wenig krude, Erinnerung an eine Landjugend, heiße Sommer auf den Feldern, Phantasien junger Spunde im strengen Katholizismus. Doch bei all den Belanglosigkeiten bübischer Streiche dräut es immer wieder durch den Text, eine diffuse Erinnerung, eine Bedrohung und ein dauernder Rechtfertigungsdrang stecken in dieser knapp anderthalbstündigen Ansprache. Immer wieder rekapituliert der Klischeepole seine Ankündigung der Erlösung, »wartet nur, bis mein Tato kommt«, Tato, das ist das polnische Wort für Vater.
Irgendwann wird seine Phantasie gewalttätiger, die Vision grotesker, das Erinnerungsmuster zu einer latenten Bedrohung. Aus ungarischen Touristen werden ledermantelbehängte Teutonenkrieger mit Maschinengewehren, die unter ihrer gestapoartigen Verkleidung (sic!) gestreifte Leinenschlafanzüge tragen, aus den Knabenphantasien zu russischen Erntefliegerinnen werden eigentümliche blonde Walküren.
Der Text sucht zweifellos im deutsch-polnischen Erinnerungsarchiv, im Bildmaterial von Verfolgung, Pogromen und nationalen Traumata. Die Ansprache Adoms ist in diesem Kontext dann nicht etwa ein Plädoyer einer verwirrten Seele vor seinem Publikum, sondern scheint der Versuch, sich vor einer undefinierten Macht freizusprechen.
Unter Umständen ist dieser Zugang aber in Zweifel zu ziehen, ob der starken Kaschierung durch das psychologisierende Dauergeschwätz dieser Bühnenfigur. Denn hinter der Sprache, der Vielzahl der Worte, schimmert die Historie nur ganz leicht durch. Tatsächlich funktioniert genau aus diesem Grund die Annäherung an das persönliche Schicksal der Figur nicht. Aber, wenn das beabsichtigt sein sollte – und so ganz klar wird das nicht – dann ist der Abend in der Tat ein deutsch-polnischer Kulturaustausch.

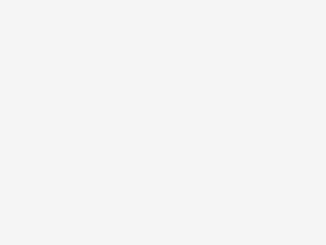
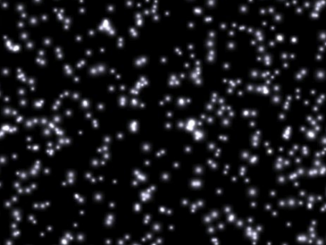

Hinterlasse jetzt einen Kommentar