

Wagner habe ich mich langsam angenähert. Die erste überwältigende Hörerfahrung war der Schluß der Götterdämmerung mit Christa Ludwig als Brünhilde und dem Philharmonischen Staats-Orchester Hamburg unter dem berühmten Wagner-Dirigenten Hans Knappertsbusch Anfang der 60er Jahre. »Starke Scheite richtet mir auf«, dann ruft sie ihr Roß Grane und reitet ins Feuer, eine selbst angerichtete archaische Witwenverbrennung. Die Klangmassen auftürmende Musik überwältigte mich derart, dass ich nicht wußte, wie mir geschah. Ich schwamm im Klang, wurde von ihm davongetragen, darüber und dazwischen die Stimme der Ludwig. Immer neue Steigerungen, bis der Klang wie eine Riesenwelle über mir zusammenschlug und ich nach Luft schnappte.
Es war überwältigend, ich fühlte mich ausgeliefert. Was war mit mir geschehen? Als Mittel der Ernüchterung las ich Theodor W.Adornos Versuch über Wagner. Was ich davon verstand, war die Warnung vor dem Rauschhaften und vor der Verherrlichung des Nichtigen, vor einer heidnischen Remythisierung. »Die wahre Idee der Oper, die des Trostes, vor dem die Pforten der Unterwelt sich öffnen, ist verlorengegangen.«
Hinzu kam Wagners diktatoriales Gehabe und sein Spott über die Juden. Den jüdischen Dirigenten Hermann Levi, der die Uraufführung des Parzival leiten sollte, demütigte er auf schlimmste Weise, legte ihm nahe, sich vorher taufen zu lassen. Erst einmal wollte ich deswegen nichts mehr hören von dem Bayreuther Gesamtkünstler, der nicht nur antisemitisch getönte Schriften verfasst, sondern dessen rauschhafte Musik den deutschen Weg in den schrecklichen Weltkrieg und die Vernichtung der europäischen Juden begleitet hatte.
Aber dann ich ließ mich Mitte der 60 er Jahre von einem guten Freund überreden und ging mit ihm in eine Aufführung der Meistersinger von Nürnberg in der Hamburgischen Staatsoper. Und ich konnte mir nicht helfen, mir gefiel die Oper schon von der ersten Szene an– in der Kirche erklingt ein Gemeindechoral, der Johannes den Täufer zum Thema hat, »Edler Täufer, Christs Vorläufer, nimmt uns gnädig an, dort am Fluss Jordan.« Zwei junge Menschen, Eva und Walther von Stolzing, wechseln während der Liturgie heftige Blicke und verlieben sich, das sprach mich an (war ich doch selber zu dieser Zeit frisch verliebt).
Ich wurde verzaubert von der Szene, in der Hans Sachs über den Zusammenhang von Fliederduft, Liebesgefühl und Gesang nachdenkt: »Wie duftet doch der Flieder so mild, so stark, so voll. Mir löst es weich die Glieder, will, dass ich was sagen soll.“ Der Johannistagjubel der Lehrbuben, das Ständchen Beckmessers, dann der Ausbruch der Aggression unter den Handwerkern, die fugierte Prügelszene in den Gassen Nürnbergs, bis noch mal der Nachtwächter auftaucht, dessen Hornruf alles beruhigt, »hört ihr Leut und lasst euch sagen« – es war wunderbar.
Die Gestalt des sprichwörtlich gewordenen Beckmesser als Judenkarikatur zu sehen, sicher, da war was dran. Aber die Komik seines von den Hammerschlägen Hans Sachsens gestörten Liedes war doch ein wunderbarer Einfall. Sachs Wahnmonolog mit dem tiefen Blick in die Eitelkeit des Lebens. Stolzings Preislied mit der Versöhnung von griechischem Parnass und christlichem Paradies. Und schließlich die Festwiese mit den politisch leicht misszudeutenden Worten Sachs: »Verachtet mir die Meister nicht und ehret ihre Kunst“, der Attacke auf welschen Dunst, und dann: « Zerging in Dunst das heilge röm‘sche Reich, uns bleibe gleich die heil‘ge deutsche Kunst.“
Sicher, eine Abwertung eines anderes Volkes, aber auch eine Vision, nach der die Gesellschaft auf einem gemeinsamem Kunstverständnis aufbauen müsse. Eine eindeutige Behauptung des Vorrangs der Kunst vor der Politik. Trotzdem wurde die Oper politisch benutzt und mißbraucht, Hitler liess sie anläßlich der Parteitage in Nürnberg und im Krieg vor verwundeten Soldaten spielen. Auch nach dem Krieg wurde sie staatstragend eingesetzt, etwa zur Wiedereröffnung zerstörter Opernhäuser. Das war mir bewußt, aber es war es in diesem Moment nicht so wichtig. Ich ging nach Hause, erfüllt von einer heiteren Handlung und einer differenzierten Musik, schwärmte meiner Freundin bei einem Mondscheinspaziergang im Jenischpark etwas vor, trällerte »Der Vogel, der da sang, dem war der Schnabel hold gewachsen,« sowie »Lenzes Gebot, süße Not« und wurde zur Belohnung geküßt.
Vierzig Jahre später inszenierte Peter Konwitschny die Meistersinger in dem gleichen Opernhaus. Die Festwiese sah hyper-idyllisch aus, allerdings breitete sie sich aus vor einem Prospekt des zerbombten Nürnberg. Als die Aufführung an die Stelle mit den deutschen Meistern und welschem Tand kam, unterbrach der Dirigent Ingo Metzmacher sein Dirigat und wandte sich direkt ans Publikum, in dem er diese Worte hinterfragte. Ein Affront für viele Wagnerianer. Für mich eine gelungene Unterbrechung. Ich hatte in der Zwischenzeit einige neue Erfahrungen mit Wagners Musik gemacht. In der Stuttgarter Oper hatte ich in den 60er Jahren einige Inszenierungen von Wieland Wagner gesehen, der mit den realistischen Kostüminszenierungen aufräumte und dank Lichtregie die Seelenregungen darzustellen versuchte.
Einmal war ich sogar bei den Bayreuther Festspielen. Normalerweise musste man Jahre warten, bis man in den Genuß der begehrten Tickets kam. Ich hatte Glück, ich bekam 1978 Pressekarten über die Frankfurter Hefte, für die ich damals regelmäßig Kommentare und Artikel schrieb. Also lieh ich mir den Smoking meines Bruders aus und fuhr nach Bayreuth, quartierte mich im Hotel zur Post ein und ging morgens zu den Vorträgen über die musikdramatischen Werke, die ich nachmittags sehen sollte: ich fühlte mich wie einer, der in die Mysterien der Wagnerschen Musik eingeweiht wird.
Ich lernte einiges über die Leitmotivik Wagners, in gewisser Weise ist der Zuhörer durch sie weiter als der Protagonist auf der Bühne. Ertönt ein Motiv, weist es auf Schicksalhaftes voraus. Dann zu Mittag essen, sich festlich anziehen, zum grünen Hügel pilgern, wo auch die Prominenz vorfährt. Es waren Festspiele wie im antiken Griechenland zu Ehren eines Gottes, eine Unterbrechung des Alltags, Gottesdienst im ursprünglichen Sinne, Weihespiele, nicht Musiktheater wie sonst, wo man nach anstrengender Berufstätigkeit abends noch schnell in die Oper hetzt und in der Mitte des 1. Aktes einschläft …
Die Sitze im Festspielhaus sind unbequem und angesichts der Länge der Wagner-Opern ist auch die Sitz-Leistung des Zuschauers nicht zu verachten. Magisch der Moment, wenn die ersten Takte aus dem verdeckten Orchestergraben erklingen. Ich sah den Ring des Nibelungen in der berühmten Inszenierung von Patrice Chereau, musikalisch geleitet von Pierre Boulez, eine bildgewaltige Parabel auf den Aufstieg des industriellen Kapitalismus und sein Profitstreben. Und dann der Parzival, das Bühnenweihfestspiel, für mich als Theologen auch eine inhaltliche Herausforderung mit der kunstreligiösen Gralsideologie und der anstößigen Formel »Erlösung dem Erlöser«.
Aber das Vorspiel, jene seltsam verklingenden nachhallenden Klangfolgen, als habe die Musik einen »Astralleib«(Adorno), der Karfreitagszauber, Klingsors Garten mit den Blumenmädchen, das war schon raffinierte Verführung, der ich mich schwer entziehen konnte. So viele Eindrücke in diesen Bayreuther Tagen, dass ich anschließend nichts zu Papier brachte. Bayreuth ist bis heute Gegenstand heftiger Kontroversen. Die von der Familie Wagner, besonders dem Patriarchen Wolfgang, verwalteten Festspiele verweigerten sich jahrzehntelang der Aufarbeitung der politischen Verstrickungen. Ob es mit seinen Töchtern, die nun in der Verantwortung stehen, anders wird, ist unklar.
Den Tristan entdeckte ich später, nach der Politisierung von 1968 und nach eigenen Liebesenttäuschungen. »Da ich nun aber doch im Leben nie das eigentliche Glück der Liebe genossen habe, so will ich diesem schönsten aller Träume noch ein Denkmal setzen, in dem von Anfang bis zum Ende die Liebe sich einmal so recht sättigen soll: ich habe im Kopfe Tristan und Isolde entworfen, die einfachste aber vollblütigste musikalische Komposition;“ schreibt Wagner 1854 pathetisch an Liszt.
Gemeinsam verfluchen Tristan und Isolde im 2. Akt den Tag, feiern die Nacht der Welt-Entrückung: »Dem Tage, dem Tage/dem tückischen Tage/dem härtesten Feinde/Hass und Klage«. Wie in Novalis Hymnen an die Nacht, die wohl das Vorbild für den ekstatischen Nachtgesang der Liebenden abgegeben haben, sehnen sie sich zur heiligen Nacht als einer neuen Form der Offenbarung: »Frau Minne will, es werde Nacht.«
Das ist die Rücknahme des biblischen »Es werde Licht« aus der priesterlichen Schöpfungsgeschichte, das Haydn in seinem Oratorium Die Schöpfung so großartig gestaltet hat. Es ist darüber hinaus die Rücknahme des Lichtgedankens der Aufklärung. Die musikalische Beschreibung von Chaos und Lichtschöpfung war schon bei Haydn mehr als naturalistische Malerei – sie war in Töne gesetzte philosophische Hoffnung auf eine bessere Welt. Diese Welt versinkt bei Wagner, dem nachrevolutionären Komponisten. Die ungelösten Widersprüche der Welt des Tags sollen aufgehoben werden im Mysterium der Liebesnacht: »O sink hernieder, Nacht der Liebe, gib vergessen, daß ich lebe …« Ein solches Projekt muss mißlingen.
In der Hamburger Tristan-Inszenierung von Ruth Berghaus wird diese Entfremdung szenisch überzeugend zum Ausdruck gebracht – die beiden Liebenden stehen einander abgewandt in einer gewaltigen Industrie-Turbine, die in einer kalt-wüstenhaften Landschaft aufragt. Wir wissen, wie die Geschichte von Tristan und Isolde endet. Tristan, in verräterischer Liebe entdeckt, wird im Zweikampf verwundet, mit einer Wunde, die nicht heilen will. Er siecht dahin, in Fieberträumen. Isolde darf endlich den Verbannten aufsuchen, zu spät, er stirbt in ihren Armen. Sie selbst stirbt den Liebestod, stirbt dem toten Geliebten nach, indem sie sich der Weise des Sehnsuchtsmotivs einverleibt, die so wundervoll und leise wonneklagend ertönt. Sie schreitet, gleitet hinüber in des »Welt-Atems wehendem All.«
Die langsame Steigerung von Isoldes Sterbegesang kommt zu ihrem Höhepunkt auf diesem Wort Welt-Atem; der wogende Schall, der tönende Schall wird musikalisches Ereignis, wird noch einmal unerhört schöner Klangrausch, indem Stimme und Orchester sich aussingen, um dann langsam zu versinken, zu verlöschen – auf dem gehaltenen Wort Lust »Mit der schwarzen Flagge, die am Ende weht, will ich mich dann zudecken, um zu sterben.« Wagners patehtischer Satz klingt in mir nach
Wagners Wirkung in der musikalischen Welt ist ungebrochen. Das Event-Marketing anlässlich von Wagners 200. Geburtstag am 22. Mai 2013 läuft überall auf vollen Touren, am intensivsten in Deutschland, das nach wie vor die meisten Opernhäuser der Welt betreibt. In Hamburg beginnt der Wagner-Wahn mit 10 Wagner-Opern im April und Mai. Ein grosser Luxus für eine kleine Schicht von Bundesbürgern, meine Wenigkeit gehört dazu, aber auch die Bundeskanzlerin, die Bayreuth jedes Jahr mit ihrem Besuch beehrt. Die von Wagner angestrebte Ästhetisierung der Gesellschaft, Kunst statt Politik, im Sommer auf dem Grünen Hügel, findet sie sozusagen schon mal statt. Danach wieder: politics as usual.

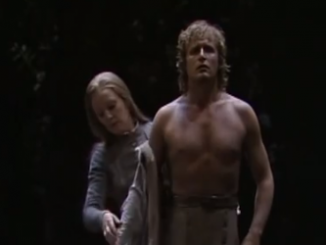

Hinterlasse jetzt einen Kommentar