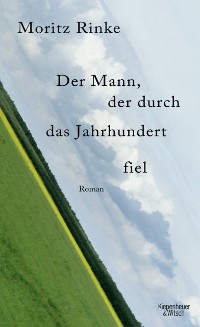
 Es war im August 2002, als der Schreiber dieser Zeilen mit einigen Freunden am Ufer eines norddeutschen Sees auf einer grünen Wiese lag. Es war ein sehr heißer Tag, und im Gepäck war eine Ausgabe von »Theater heute«. Im Heft war – wie immer – ein Stückabdruck und aus purer Laune heraus begann die Sommerfrische-Gesellschaft dieses Stück auf einer Wiese im Augustsommer mit verteilten Rollen zu lesen. Erst auszugsweise, immer wieder unterbrochen von Gelächter und der Aufforderung weiter zu machen. Diese recht tschechowsche Szene hat es tatsächlich gegeben, das Stück hieß »Die Nibelungen« und der Autor hieß Moritz Rinke. Am Abend des so unterhaltsamen Diletto wurde die Première bei den Wormser Nibelungen-Festspielen auf 3sat übertragen, zugerichtet von Dieter Wedel, der vom Theater leider nur so viel versteht wie Edmund Stoiber von Rhetorik. Dafür verstand der Autor um so mehr von Dramaturgie und Witz und das hob das theatrale Centerfold aus »Theater heute« aus den vielen Stückveröffentlichungen »junger Autoren« des Zentralorgans der deutschen Bühnenlandschaft weit heraus. Benamt als Bearbeitung Hebbelscher Tümeleischwang sich der Nationalkracher dunkler Epoche zu einer Leichtigkeit empor, die das Thema verdient hat und aus dem ebenso dunklen Sumpf seiner Rezeptionsgeschichte herausholte. Für Rinkes brillante Beherrschung des Theatermetiers sprechen auch die früheren, ebenso elegant konstruierten wie in der Ideierung originellen Werke »Der Mann, der noch keiner Frau Blöße entdeckte« (auch ein Rückgriff in pränationale Zeiten) oder das Erfolgsstück »Republik Vineta« von 2000.
Es war im August 2002, als der Schreiber dieser Zeilen mit einigen Freunden am Ufer eines norddeutschen Sees auf einer grünen Wiese lag. Es war ein sehr heißer Tag, und im Gepäck war eine Ausgabe von »Theater heute«. Im Heft war – wie immer – ein Stückabdruck und aus purer Laune heraus begann die Sommerfrische-Gesellschaft dieses Stück auf einer Wiese im Augustsommer mit verteilten Rollen zu lesen. Erst auszugsweise, immer wieder unterbrochen von Gelächter und der Aufforderung weiter zu machen. Diese recht tschechowsche Szene hat es tatsächlich gegeben, das Stück hieß »Die Nibelungen« und der Autor hieß Moritz Rinke. Am Abend des so unterhaltsamen Diletto wurde die Première bei den Wormser Nibelungen-Festspielen auf 3sat übertragen, zugerichtet von Dieter Wedel, der vom Theater leider nur so viel versteht wie Edmund Stoiber von Rhetorik. Dafür verstand der Autor um so mehr von Dramaturgie und Witz und das hob das theatrale Centerfold aus »Theater heute« aus den vielen Stückveröffentlichungen »junger Autoren« des Zentralorgans der deutschen Bühnenlandschaft weit heraus. Benamt als Bearbeitung Hebbelscher Tümeleischwang sich der Nationalkracher dunkler Epoche zu einer Leichtigkeit empor, die das Thema verdient hat und aus dem ebenso dunklen Sumpf seiner Rezeptionsgeschichte herausholte. Für Rinkes brillante Beherrschung des Theatermetiers sprechen auch die früheren, ebenso elegant konstruierten wie in der Ideierung originellen Werke »Der Mann, der noch keiner Frau Blöße entdeckte« (auch ein Rückgriff in pränationale Zeiten) oder das Erfolgsstück »Republik Vineta« von 2000.
Nun hat Moritz Rinke seinen Debut-Roman mit dem etwas eigenartigen Titel »Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel« geschrieben. Das erwähnte Jahrhundert ist das letzte, das schreckliche deutsche Jahrhundert. Der Mann ist Paul Wendland, ein – wie sein Autor Rinke – in die Hauptstadt-Fremde gezogener Worpsweder, der dem Kunstdruck des Künstlerdorfes seiner Kindheit entflohen ist. Aus seiner Berliner Emigration muss er zur Rettung seines im Moorboden versinkenden Elternhauses zurückkehren – kaum angekommen muss er sich nicht nur der Baubewältigung des »Grundbruchs« stellen, sondern auch dem so verhassten Moor (»Mein ganzes Leben nasse, sumpfige Füße …«). Das nämlich gibt in schöner Wiederkehr Skulpturen seines einigermaßen berühmten und ehrenwerten Bildhauer-Großvaters Paul Kück frei, deren Vorbilder lokale Nazi-Größen waren. Sie tragen so ungemein deutsche Titel wie Reichsbauernminister oder gar Reichsbauernführer.
Wie in den Stücken hat das Buch ein nicht zu verleugnendes Gespür für den Gestus, in dem die Bewältigung der Historie sich von dräuend bleischwerer Bewältigungsprosa anderer Werke ins Tragikomische umkehren muss. Die große Stärke dieses Romans ist es, seinem Stoff nicht in echter Weise »gerecht« zu werden.Was hat die deutsche Literatur nicht alles Ehrenwertes produzieren müssen, um die besonderen Schreckensjahre dieses »deutschen Jahrhunderts« zu verarbeiten – Rinkesklitzekleiner Entwicklungsroman vor großem Hintergrund ist in bester Lubitsch-Manier erschreckend komisch. Es gibt unglaublich groteske Szenen, wie den zunächst am grüßenden Arm der Skulptur scheiternden Versuch, den Reichsbauernführer des Nachts mit einem Trecker verschwinden zu lassen und seinen anschließenden Abtransport durch die Nacht. Skurril wiederum sind dann die Verknüpfungen zur ur-deutschen Geistesgeschichte, so gehört auch ein »Rilkekochtopf« zum Inventar des Moorhauses.
Das modernde Moor als den Grund und Boden seiner Geschichte zu wählen, ist wirklich grundoriginell, ebenso wie das Auftauchen der ehernen Nazifiguren aus dem braunen Sumpf. Der Geschichtssumpf legt dann in Folge nicht nur die braune Vergangenheit bloß, so ganz nebenbei trägt sich die Erzählung durch die Nachkriegsjahre inklusive der 68er-Zeit und bildet zudem noch ein Art Kriminal-Handlung aus – fast zu viel der Verwobenheit, aber als erfahrener Dramaturg bekommt Rinke so etwas relativ spielend in den Griff. Der Roman ist exzellent strukturiert und wie die vergeblichen Versuche seines Helden, sein Erleben durch Statuslisten zu ordnen, in eine erkleckliche Anzahl an Kapitel und Unterkapitel geteilt, die zudem hübsch barocke Überschriften zieren wie beispielsweise: »Ohlrogge kann immer noch nicht loslassen und trinkt Kaffee von 1933«. Eine leichte sprachliche Verspieltheit ist dem Autor ohnehin nicht abzusprechen: »Um sie herum purzelten die Kinder auf die Welt, heimsten die anderen Kückfrauen Mutterkreuze ein, nur sie empfing nichts …«
Am Ende versinkt das Haus der Vergangenheit und Paul Wendland zieht die nassen, sumpfigen Füße aus dem Moor …
Jetzt muss man nur noch wieder zur Wiese am See fahren.
Moritz Rinke:
Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel



Hinterlasse jetzt einen Kommentar