
»Eine medizinisch-theatrale Recherché über Leben und Tod im deutschen Gesundheitswesen« nennt Tuğsal Moğul seinen aktuellen Abend WIR HABEN GETAN, WAS WIR KONNTEN im Malersaal des Deutschen Schauspielhauses Hamburg. Der diplomierte Schauspieler, Anästhesist und Notarzt arbeitet neben seiner 50-Prozent-Stelle in einem Lehrkrankenhaus in Münster – mehrfach ausgezeichnet – als Autor und Regisseur. Stücke wie HALBSTARKE HALBGÖTTER oder LASSEN SIE MICH DURCH, ICH BIN ARZT beschäftigen sich mit den absurden wie dramatischen Umständen, die ein durchökonomisiertes Gesundheitssystem mit sich bringt. Die Uraufführung seines neuesten Stückes DEUTSCHE ÄRZTE GRENZENLOS ist für den 26. Januar 2021 am Theater Münster geplant.
Viele deiner Stücke machen Entwicklungen an unseren Krankenhäusern zum Thema. Bei »Halbstarke Halbgötter« bist du bei der Vermischung von Medizin und Theater so weit gegangen, die Schauspieler ans EKG anzuschließen. Was haben Theater und Operationssaal für dich gemeinsam?
Das Interesse, den Menschen in seinem Innersten zu begreifen. Im Stück waren es Life-EKGs, wie wir sie auf der Intensivstation nutzen, die die Herzfrequenz der Schauspieler während der Vorstellung maßen. Die Wirkung war enorm. Man sieht ja das Herz förmlich auf der Bühne.

Wo schlägt dein Herz stärker – auf der Bühne oder im OP?
Ich glaube, ich habe mein Herz mittlerweile geteilt. Bei »Wir haben getan, was wir konnten« war es besonders krass: Wir hatten am Freitag Première, und in der Woche drauf saß ich wieder in Münster im OP-Saal und habe Narkosen gemacht – mit dem Wissen, die letzten sechs Wochen hast du im Theater verbracht und dich eigentlich mit dem Überbau des Medizinthemas beschäftigt. Ich weiß, dass ich das Krankenhaus als einen Ort empfinde, an dem ich auf jeden Fall sein will – und wo ich meine Quellen habe – durch den Kontakt zu den Kollegen und Patienten: vom Harz-4-Empfänger bis zur Professorin kommen alle in die Anästhesiesprechstunde.
Dein Blick auf die Medizinwelt ist gnadenlos und liebevoll zugleich. Wie siehst du den Klinikalltag heute?
Als ich von Niels Högel las (Der Krankenpfleger hatte Patienten lebensbedrohliche Medikamente gespritzt, um sie danach zu reanimieren. Am Tag nach der Première wurde er in 85 Fällen wegen Mordes schuldig gesprochen, Anm. d. Red), war meine erste Reaktion, das hätte überall in Deutschland passieren können. Das System ist so überfordernd, das medizinische Personal so unter Druck, dass man gar nicht mehr die Möglichkeit oder die Lust hat zu fragen, wie es dem Kollegen geht oder wie er seinen Job macht. Hätten die Chefärzte sich von den Medizinökonomen nicht das Ruder aus der Hand nehmen lassen, hätten wir heute vielleicht wirklich das beste Gesundheitssystem der Welt.
Aber durch die Agenda 2010 und durch die Privatisierung der Kliniken standen Tür und Tor für geldgierige Konzerne offen, um sich die Kliniken anzueignen und daraus Wirtschaftsunternehmen zu machen. Seitdem sind Krankenhäuser Dienstleistungsunternehmen: Wir müssen gewisse Leistungen erbringen, damit das Haus ein Plus erwirtschaftet. Und dafür werden sehr viele OPs durchgeführt, die womöglich gar nicht indiziert wären – auch wenn ich als Anästhesist natürlich nicht befugt bin, das zu beurteilen. Aber die Anzahl an Arthroskopien, Hüftgelenks- oder Herzkatheter-OPs hat in den letzten 20 Jahren enorm zugenommen. Die Konzerne konzentrieren sich darauf, während andere Fachbereiche wie Kinderkliniken eben nicht profitabel sind. Wir sind natürlich nicht das einzige Land, in dem es so läuft, das ist eine globale Entwicklung.
Wie hat die Corona-Zeit dich als Arzt beeinflusst?
So seltsam es klingt: Sie hat dazu geführt, dass ich mich wieder als Arzt gefühlt habe. Ich hatte wieder mehr Verantwortung. Eine Klinik funktioniert im Alltag ja wie eine Fabrik. Du kommst morgens hin, siehst, welche OPs du hast und ziehst die durch. Aber in der Corona-Zeit waren plötzlich viele Meinungen möglich, und die monetäre Kausalität war außer Kraft gesetzt. Ideen waren gefragt. Man hat gemerkt, dass das System lebt, die Wertschätzung untereinander gespürt.
Was hat Corona mit dir als Regisseur gemacht? Abgesehen von den ökonomischen Zwängen – wie kann Theater jetzt funktionieren, bevor es die Impfung gibt?
Mein Stück »Deutsche Ärzte grenzenlos« sollte am 12.03.2020 in Münster uraufgeführt werden. Zwei Stunden davor waren wir im Lockdown, weil 25 Leute im Theater positiv getestet wurden. In den Malersaal im Schauspielhaus dürfen zu »Wir haben getan, was wir konnten« momentan 30 Zuschauer. Bei der Première saßen gefühlt 20 Kritiker und 10 reguläre Besucher. Das fühlt sich eher wie ein mündliches Staatsexamen an. Ich muss ehrlich sagen, bei der Première hätte ich nicht Schauspieler sein wollen. Es ist so viel schwerer, den Zauber herzustellen. Natürlich ist es wichtig, weiter Theater zu machen, aber es ist ein stark verändertes Erlebnis – für das Publikum wie für die Schauspieler. Man merkt, die Zuschauer sind verhalten. Sie gehen nicht mehr so in der Gruppe auf wie zuvor.

Jeder von uns hat diese Ärzte in den Kliniken schon gesehen – zeitlich und kräftemäßig am Limit. Warum ist das System so?
Ärzte sind sicher hochgebildet, aber bis zu einem gewissen Grad masochistisch veranlagt. Man klagt nicht. Übrigens ähnlich am Theater: Man hält keine Ruhezeiten ein, ist immer da. Klagen ist etwas Verpöntes, und deswegen gehen alle über ihr Limit. Mit Ende 20, Anfang 40 kann man alles noch kompensieren und schafft auch einen 24-Stunden-Dienst. Irgendwann habe ich persönlich gemerkt, ich schaffe das nicht mehr. Da fiel dann die Entscheidung für eine 50-Prozent-Stelle, und dafür, die restlichen 50 Prozent meinen anderen Beruf zu machen.
Irgendwie ist beiden Systemen eine gewisse Selbstaufgabe eigen. Dieses Sich-mit-Haut-und Haar-Hineinstürzen wird sowohl am Theater erwartet als auch im Klinikbetrieb, oder? Du hast dir ja gleich zwar »Mit-Haut-und-Haar-Berufe« ausgesucht.
Irgendwas kann mit mir nicht stimmen, oder? (lacht) Das Gute ist: Ich habe nicht den Druck, jedes Jahr zwei bis drei Inszenierungen machen zu müssen. Wenn mich ein Thema anspringt wie diese drei Krankenhausverbrechen in »Wir haben getan, was wir konnten«, dann kann ich das machen. Ich finde es wunderbar, Menschen am Theater zu begegnen, die es wirklich schaffen umzusetzen, was ich mir ausdenke – das berührt mich enorm. Für meine Art zu arbeiten, ist das Vertrauen der Schauspieler enorm wichtig. Wenn ich das bekomme, ist so viel möglich.
Bei dir ruft nicht die Dramaturgin an und sagt, wir machen nächste Spielzeit Stück X. Du kehrst das System eher um.
Ich melde mich und sage, ich habe was für euch. Ein Thema muss mich triggern. Mein NSU-Stück »Auch Deutsche unter den Opfern« beispielsweise – da habe ich mich bei jeder neuen Mordmeldung gefragt: Wer bringt denn so wahllos Menschen um? Das Theater Münster hat mir Zeit für die Recherché gegeben. Also war ich über neun Monate hinweg immer wieder in München bei den Prozessen.
Ich hatte eine solche Wut im Bauch: All die Fehler, die bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei entstanden sind – ich fand es unfassbar, bei dem Prozess immer nur von Einzeltätern zu hören und dass nie zugestanden wurde, dass es eine organisierte Terrorgruppe war. Immer wurde die Schuld nur in der Verwandtschaft oder Nachbarschaft oder unter den Freund*innen der Opfer gesucht. Dass man nicht mal auf die Idee gekommen ist, dass es Nazis waren…! Migration, Rassismus, Medizin, das sind die Grundthemen, wozu ich immer wieder Ideen für die Bühne entwickeln möchte. Ich liebe Tschechow, aber ich weiß nicht, ob ich einen »Ivanov« machen will.

In deinem aktuellen Stück »Wir haben getan, was wir konnten« kommt Musik von Purcell vor, und die Kostüme haben Barockelemente. Bei allen Figuren geht es um Macht über Leben und Tod. Ich musste an die Herrscher dieser Zeit denken – völlig der Realität enthoben und von Macht besessen.
Alle drei Figuren haben die Nähe zu Krankheit und Tod – das war in der Barockzeit durch Pest und den 30-jährigen Krieg auch so. Zudem der schöne Schein: Unter den kunstvollen Perücken mieft es, es modern die Pilze. Und für mich gab es eine Parallele zu diesen durchökonomisierten Krankenhäusern, die immer schöner werden: diese Empfangsbereiche mit ihren Klavieren, die eher wie ein Hotelfoyer anmuten, aber hinten läuft diese Maschinerie mit viel zu wenig Personal und verknappten Ressourcen. Und die drei Figuren, diese Antihelden, sollten, auch wenn sie schreckliche Menschen sind, nicht so exponiert dastehen. Ich wollte zeigen, dass so etwas nur in einem dermaßen mit Geld aufgeblähten System möglich ist.
Und ja, es geht um diese Form von Macht, Entscheidungen über Menschen zu fällen. Wenn ein Apotheker Chemotherapie-Medikamente an die Patienten weitergibt, die nur zehn Prozent des Wirkstoffs enthalten, das aber bei den Kassen voll abrechnet – diese Hybris, sich über Leben und Tod zu erheben, das passt schon auch in die Barockzeit. Högel, der erzählt, wie er es genossen hat, Menschen zu reanimieren, der mit ihrem Tod spielt, um sie wieder ins Leben zurückzuholen – das hat etwas irre Absurdes, im negativen Sinne Gottgleiches. Oder die Figur der Irene Becker, die ausspricht, was viele Krankenpfleger denken: Der Patient hat Parkinson, Alzheimer und einen Herzinfarkt – was soll man da noch therapieren? Oft fragen wir uns das auf der Intensivstation, wenn eine 90-Jährige noch eine große OP bekommt und man weiß, sie wird danach bettlägerig sein, körperlich oder geistig schwer behindert. Wenn man damit täglich konfrontiert ist, können solche Abartigkeiten wie in den drei geschilderten Fällen entstehen.

Im Stück wird deutlich, dass die drei Kriminalfälle nur durch jahrelanges Wegschauen möglich sind. Begünstigt das Krankenhaus-System das Wegschauen? Oder ist es womöglich sogar symptomatisch für unsere Gesellschaft? Ist es umso wichtiger, dass man im Theater hinschaut?
Gute Fragen. Wir unterschreiben zwar alle das Ärztegelöbnis, den modernen hippokratischen Eid, aber der ökonomische Druck ist so groß geworden, dass bestimmte ethische Fragen hintangestellt werden. Beispielweise werden Chefärzten Bonizahlungen in Aussicht gestellt, wenn sie in einer bestimmten Zeitspanne noch mehr operieren – und bei Schwestern und Pflegern wiederum wird gekürzt. Ob die Gesellschaft an sich die Würde des anderen anerkennt und Mitmenschen Respekt zollt, spiegelt sich im Krankenhaus wider.
Ich glaube sowieso, dass das Krankenhaus einen Mikrokosmos unserer Gesellschaft abbildet. Am OP-Tisch ist der Operateur aus Kamerun, der Assistenzarzt Rumäne, die Schwester kommt aus Polen – und die Patientin auf dem Tisch heißt Ute. Das bildet die Strukturveränderungen der deutschen Gesellschaft viel deutlicher ab als Theater es je könnte. Hier ist es noch nicht normal, Hamlet mit einem Schauspieler aus Kamerun zu besetzen – ohne dass das kontextualisiert wird.
Wenn also das Krankenhaus die Gesellschaft abbildet mit all dem Potenzial, was da an Zwischenmenschlichem möglich ist, wenn es fungiert wie ein Brennspiegel – kann das Wegschauen dann als symptomatisch angesehen werden?
Gerade was wir an politischen Haltungen weltweit beobachten können, findet man natürlich am Krankenhaus wie unter einem Brennspiegel versammelt. Da trifft man auf den Erzkonservativen ebenso wie auf den linksliberalen Menschen. Es ist also schon eine gute Abbildung. Und was die Werte der Gesellschaft angeht: Die Durchökonomisierung finden wir letztlich überall – und in den Krankenhäusern führt sie dazu, dass ethische Fehlentscheidungen getroffen werden. Patienten haben ja immer noch die Hoffnung, dass ihnen im Krankenhaus geholfen wird – was ja auch passiert. Aber du siehst die Schwestern rennen, alle sind im Stress. Das mag in allen Bereichen so sein. Aber wenn es um Menschen geht, um Leben und Tod, passt Ökonomie einfach nicht als Konzept.
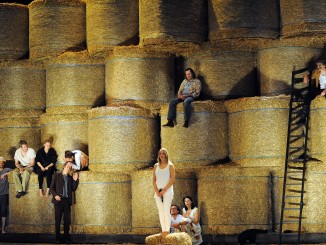


Hinterlasse jetzt einen Kommentar