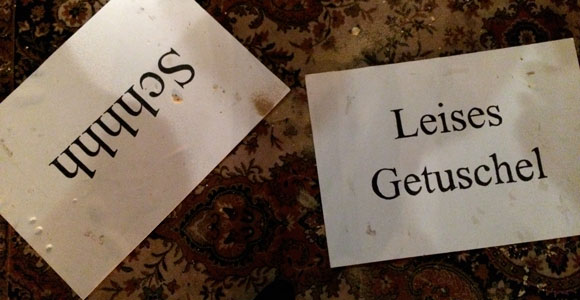

Schon im Foyer beginnt’s. Es wird um Ruhe gebeten, einer der Schauspieler (Julian Greis) schwingt sich auf ein Podest, auf dem auch ein Boot steht, die »Hope«. Man kenne das ja, sagt er, wenn vor einer Vorstellung einer was sagen würde, wäre das meist kein gutes Zeichen. Und so sei es auch in diesem Fall. Einer ihrer Darsteller – der unaussprechliche afrikanische Name führt zu Gelächter im Publikum – sei nicht aufgetaucht, zu den Gründen könne man hier nicht viel sagen. Aber nach einem Telefonat mit Joachim Lux habe man beschlossen, jemanden aus dem Publikum zum Lesen des Eingangsmonologes zu bitten.
Ein kleiner Tumult, man redet durcheinander, und schon findet sich – sicher rein zufällig – eine junge Dame, die das Podest erklimmt und mit den vier Schauspielern auf der Bühne den Anfangsmonolog performt. Katinka, 34, macht das ganz entspannt. Sie sei etwas erkältet gewesen, entschuldigt sie sich, aber nein, sagt sie auf Greis‹ besorgte Nachfrage, Afrika habe sie noch nie besucht. Nichtsdestotrotz zaubert das Restensemble je einen Mundschutz aus der Hosentasche. Bei Afrika weiß man ja nie so genau. Und so erfahren wir die Geschichte von Ultimo, der »Piraterie« in Mogadischu studiert hat, weil die wohlhabenden Nationen die Fischgründe seiner Heimat leergefischt haben.
Mitten drin sind wir in den Themen der Globalisierung, und damit das keine schlechte Laune macht, wird eine Art Michael Jackson-Medley angestimmt, von »Heal The World« bis »They Don’t Really Care About Us«. Das Publikum wird ins »Radiostudio« gebeten. An der hinteren rechten Bühnenwand blinkt das »ON AIR«-Zeichen. Die Bühne selbst eine Art Versuchslabor der Geräusche. Drei Tische mit Utensilien zum Geräusche-Machen, eine Mikrofonkabine, ein paar Lampen. Alles wirkt aufgeräumt, die theatralen Mittel stehen ganz offensichtlich bereit. Das Spiel kann beginnen – wenn es das nicht längst schon hat.
Das Publikum wird darauf hingewiesen, dass, sobald das »ON AIR«-Zeichen zu blinken aufhöre, alles live übertragen werde. Es ist mitverantwortlich für die Atmosphäre, und ganz offensichtlich hat es seine helle Freude daran. In drei Gruppen eingeteilt, bekommt es Aufgaben zugewiesen – von frenetischem Applaus und Buh-Rufen zu Beginn der Radioshow bis hin zu Dschungelgeräuschen wie »Tsssssss« oder »Schhhhhhh«, wenn wir in das »Herz der Finsternis« reisen.
Doch was wird denn nun im Radio übertragen? Zu Besuch im Studio ist Oberfeldwebel Oliver Pellner (Nicki von Tempelhoff) und sein Adjutant Stefan Dorsch (Pascal Houdus). Das Interview führt ein aufgeregter Radiomoderator (Julian Greis). Camill Jammal ist für die Geräusche und das Klavier zuständig – zunächst zumindest. Da sind von vornherein Ungereimtheiten in Pellners Geschichte, die den Moderator verwirren. Der Hindukusch, betont Pellner immer wieder auf Nachfrage des Moderators, sei definitiv ein Fluss, kein Gebirgsmassiv. Pellners Geschichte duldet keine Widerrede, und so nimmt sie uns mit auf den dunklen Strom namens Hindukusch, der in die Tiefen des animalischen Dschungels entführt.
Pellner hat den Auftrag, Karl Deutinger zu finden, einen deutschen Offizier, der in der Wildnis wahnsinnig geworden sei und zwei seiner Kollegen getötet habe.
Doch scheint diese wahnwitzige Reise ohne Plan, daran verzweifelt Unteroffizier Dorsch immer wieder aufs Neue. »Was ist unser Auftrag?« will er von Pellner wissen, während die Mücken sie zerstechen, Regen, Blitz und Donner über sie hereinbrechen und auch, als sie in einem italienischen Blauhelmlager landen, das versehrte Einheimische vor den Übergriffen der Taliban schützen soll. »Was ist unser Auftrag?« fragt Dorsch, während der Moderator in seiner Aufnahmebox fast verrückt wird, weil der Dschungel durch alle Ritzen kommt. Erdverschmiert und verschwitzt kämpft Greis in seiner Kabine dagegen an, dass die Geschichte Überhand nimmt.
Nach und nach nimmt das Geschehen von der Gaußstraßenbühne Besitz. Da Regisseur Christoph Rüping die Zitatebene immer wieder explizit betont, ist das manchmal beklemmend, meist aber voll Ironie und böser Komik – beispielsweise dann, wenn alle »Wumbawumba«-Laute von sich geben sollen, um die Geräuschkulisse der verstümmelten Eingeborenen darzustellen. Auch wenn Greis und Houdus (im rosa Glitzerkleidchen) die Geschichte vom »Lippenbär«, einem Sextouristen im Nirgendwo, erzählen. Oder dann, wenn Greis als vermeintlicher Kroate Bojan Stojkovic die tragische Geschichte vom Untergang seiner Familie dazu missbraucht, dem Publikum letztlich seine rechte Socke zu verkaufen. Grandios komisch auch Jammal, wenn er – ausgestattet mit Wattebauch und Tamponaden im Mund – zum verzweifelten Kommandanten Lodetti im Blauhelmlager wird, der im Dschungel am meisten die Pizza Pomodore e Mozzarella vermisst – und natürlich das »Internetz«. Es ist zum Verzweifeln.
Zwischendrin immer wieder »Werbepausen« – oder Lesezeit von »Das Herz der Finsternis«, dem Originaltext von Joseph Conrad, der 1979 Francis Ford Coppola zu seinem Vietnam-(Anti-)Kriegsfilm »Apocalypse Now« als Vorlage diente. Im Text von Autor Wolfram Lotz, der wiederum Coppolas Film als Vorlage angibt, verschwimmen die Orte, es gibt keinen konkreten Schauplatz, nur Szenarien der Globalisierung. Ein endloser, undefinierter Unort von Globalisierungsschauplätzen entsteht, und so ist es nur konsequent, dass dieser Ort von der Bühne Besitz ergreift und schließlich sogar den Autor ins Geschehen holt. Dorsch – oder der Schauspieler Houdus? – fordert den Autor im Publikum heraus. Wie einst die Figuren in Pirandellos »Sechs Personen suchen einen Autor« steht er, die Arme in die Seiten gestemmt vor Lotz. »Was ist unser Auftrag?« fragt er, und Lotz, am Abend der Uraufführung selbstverständlich im Publikum, gesteht ganz ruhig und etwas hemdsärmelig, dass er das selbst nicht weiß.
Dass der Abend in vielen Versionen enden kann, ist somit klar. Dass er sich selbst immer wieder in Frage stellt, zum schönsten Meta-Theater wird, auch. Aber was ist denn nun eigentlich unser Auftrag? Was wollen wir in einer Gesellschaft ohne Glauben, fragt Dorsch, was sollen wir in dem Dschungel unserer Wahrnehmung, kurz: am Arsch der Welt? Die Bühne ist im Chaos, die Schauspieler verschwitzt und das Publikum ganz still. Jeder möge hier selbst seinen Auftrag finden, soviel ist klar, und sich nicht verlaufen im Dschungel der eigenen Geschichte. Und bitte, das darf auf keinen Fall passieren, in der vollständigen Demontage dieses Nicht-Theaterabends.
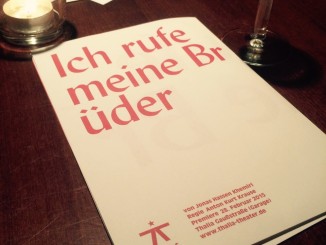


Hinterlasse jetzt einen Kommentar