Ja. Da fängt »Woyzeck» mit dem Märchen von der Sonnenblume an. Das ist nicht neu, eher konservativ. Und stimmt ein in die »Geschichte eines Paupers«. Am Ende der Geschichte kommt das Märchen noch einmal, die Klammer wird geschlossen. Und dazwischen?
Mit Wilsons Bildertheater hatte Jette Steckels Première letzten Samstag nichts zu tun. Mit Wilsons Theater – ausser der Fassung – auch nichts. Geblieben waren die Songs von Tom Waits, der, so sagt er, wie Kurt Weill »eine schöne Melodie« nimmt und »schreckliche Dinge« erzählt. Schreckliche Dinge hat Büchners Stück genug zu erzählen, allein das Wechselspiel zwischen Melodie und Geschichte funktioniert überhaupt nicht. Das Thalia-Ensemble müht sich redlich, singen können sie alle beeindruckend, das Orchester im Graben unter der Leitung von Gerd Bessler ist hervorragend besetzt. Nun hatte Wilson sein Theater einst mehrdimensional angelegt, mit klaren Schwerpunkten auf Visualisierungen (Licht!) und Ton (Waits!). Und hier? Von der vor Jahren revolutionären Bildlichkeit ist nichts mehr übrig, die Bühne ist öd und leer. Das gibt Raum. Unter dem Bühnenhimmel ist an seine vier Ecken ein bemerkenswertes Gebilde aufgehängt, halb Bettgestell, halb Trampolin, bespannt mit einem elastischen Gitterwerk, das je nach Lage und Szene unterschiedlich herabgelassen wird. Es dient als erweiterte Spielfläche und hebt einen Grossteil der Aktion weg vom Boden in eine zweite Ebene, die sportive Leistung der dort hängenden und agierenden Darsteller ist bewundernswert. Aber ohne Erde.
Schwer fällt die szenische Übersetzung, ungereimt ist da so manches. Nach dem stillen Anfang folgt grosses Getöse, der bespannte Rahmen wird herabgeklappt, in den Seilen hängt das Ensemble und stimmt den ersten Chorus an. Bald folgt die Barbierszene (›Er sieht immer so gehetzt aus.‹), da hängt der Hauptmann mit ausgebreiteten Armen im Netz, das Seitenlicht wirft hübsche Schatten auf den Bühnenboden, wir sehen dadurch die Figur dreimal. Golgatha? Der Erlöser? Wie bitte? Oder hat das keiner gemerkt?
Nun folgt Szene um Szene, dazwischen immer wieder Waits Nummern. Felix Knopp, ein zierlicher und zugleich kraftvoller Woyzeck, krächzt und brüllt, so richtig schön waitsmässig. Überhaupt wird immer dann, wenns mal »wahnsinnig« wird, ziemlich laut Musik gemacht. Auch schön, daß Woyzeck zum Spiegel der Narrenfigur wird und beide im synchronen Irrentanz (so ist das doch, oder?) die Erkenntnis packt, daß Marie sich den Tambourmajor erwählt hat. Irre schreien laut und zappeln. Aha.
Und dann wieder ein Song, im Anschluss an das Zusammentreffen Woyzecks mit dem Tambour. Erst wird gerangelt und bedrohlich gerungen, Woyzeck, die arme Sau unterliegt natürlich. Und zum Schluss umhalsen sich die Beiden, um gemeinsam ins muntere Liedchen einzustimmen. Ja, »Brandewein das ist mein Leben«. Auch schön.
Und gelingt es, das Spiel einmal dicht zu machen, die schön gebaute und innig berührende Mordszene an Marie ist ein kleiner theatraler Glücksmoment an diesem Abend – dann dauert es nicht lange und die Musik setzt wieder ein. So funktioniert das heute im Fernsehspiel, keine Stille sein lassen, ja kein Vertrauen in Wirkung haben. Musik macht Stimmung. So hangelt sich der Abend dann von Nummer zu Nummer, zwischen drin wird mal beachtlich und mal belanglos die Moritat gespielt und am Ende gibt es dann uneingeschränkten Beifall, nicht mal ein »Buh« war zu erahnen.
Muß man sich nicht die elementare Frage stellen: Was passiert, wenn man den bunten Reigen zwischen erzählter Geschichte und musikalische Einlage, der damals im »Black Rider« noch so gut funktioniert hat, komplett seines visuellen Zaubers entkleidet? Schon Wilson hat damals die Narration der Freischütz-Legende eher als Leitfaden genutzt, um die Geschichte musikalisch wie visuell zu emotionalisieren. Schon damals war das bald schal, der Effekt schnell verraucht. Nimmt man die Geschichte nur bedingt war und versucht sie allein durch die Musik zu emotionalisieren, was bleibt denn dann noch?
Das war ein belangloser »Woyzeck«.

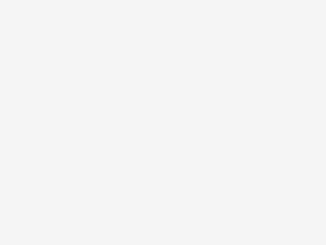

Hinterlasse jetzt einen Kommentar