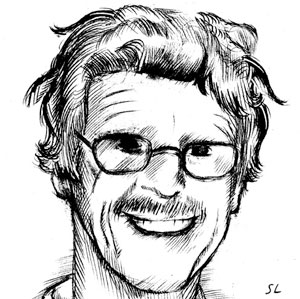
 Martin Walser hat ein kleines theologisches Buch geschrieben: »Über Rechtfertigung, eine Versuchung.« Der 85 jährige Schriftsteller, seit seinem Roman »Ehen in Philippsburg« 1957 eine literarische Institution der Bundesrepublik, hat zuletzt sich in seinem ausladenden Alterswerk »Muttersohn« bereits mit dem Glauben und der religiösen Dimension des Lebens intensiv beschäftigt.
Martin Walser hat ein kleines theologisches Buch geschrieben: »Über Rechtfertigung, eine Versuchung.« Der 85 jährige Schriftsteller, seit seinem Roman »Ehen in Philippsburg« 1957 eine literarische Institution der Bundesrepublik, hat zuletzt sich in seinem ausladenden Alterswerk »Muttersohn« bereits mit dem Glauben und der religiösen Dimension des Lebens intensiv beschäftigt.
Nun aber – eine kleine theologische Streitschrift, die es in sich hat. Martin Walser erinnert mit Kafkas Josef K., mit Robert Walsers, Thomas Manns und Jean Pauls Romanfiguren daran, dass es im Leben des Menschen entscheidend um Frage geht, ob er gerechtfertigt sei. Er lobt die Selbstverneinungsorgien dieser Autoren. Und er entdeckt den frühen Karl Barth des Römerbriefs, jenen richtungsweisenden Schweizer Theologen des 20. Jahrhunderts, und er entdeckt dessen sprachgewaltig dialektischen Versuch der Beschreibung der Situation des Menschen vor Gott, zitiert ihn seitenlang enthusiasmiert: »Der Glaube bleibt nur als Glaube übrig, ohne Selbstwert, ohne Eigenkraft, ohne eine Größe sein zu wollen, weder vor Gott noch vor den Menschen«. Er steht voll und ganz zu der Aussage Barths, dass der Mensch vor Gott immer der Angeklagte bleibt.
Walser entdeckt und bekräftigt mit Paulus und vor allem mit dem radikal intoleranten Augustinus Gottes menschlich gesehen ungerechte Gnadenwahl – dass er den Erstgeborenen, Esau, verwirft und Jakob erwählt. Das was mit diesem Motiv passiert, solle man lesen wie einen Roman, schlägt Walser vor. Er zitiert Paulus, »Wer bist du Mensch, dass du mit Gott rechtest.« Und fragt dann: »was müssen diese Menschen erfahren haben, dass sie Gott so groß und den Menschen so klein erlebt haben.« Ich jedenfalls, bekennt Walser, bleibe Augustins Bewunderer.
Zugespitzt sagt er: »Rechtfertigung ohne Religion wird zur Rechthaberei.« Wir seien »Rechthabezwerge«, unser ganzes Leben sei darauf ausgerichtet recht haben zu wollen, auch er selber habe daran Anteil. Das »Bedürfnis nach Rechtfertigung« sei uns verlorengegangen. Wir heutigen Menschen seien solche ‚die andere und die Verhältnisse anklagen, anstatt die Schuld einmal bei uns selber zu suchen. Wir sollten endlich einmal zugeben, dass uns etwas fehlt, dass uns Gott fehlt. »Meine Muse ist der Mangel.« Das treibe ihn zum Schreiben. Und er verweist auf Nietzsches Dionysos-Dithyramben, in denen er Ariadne so herrlich klagen lässt: »O komm zurück, mein unbekannter Gott, mein Schmerz, mein letztes Glück.«
Und er zitiert den Barth-Satz – zwei mal sogar: »Als der unbekannte Gott wird Gott erkannt, als der ‚an den man nur ohne Hoffnung auf Hoffnung hin glauben kann.« Also der Schmerz, das Leiden ist es, was den Menschen über sich hinaustreibt. »Schön wird etwas nur durch bestandenen Schmerz«. So sei es bei Äschylos‘ Prometheus, so bei Hölderlin, Kafka, so auch in Nietzsches Ecce homo und selbst noch im Anti-Christ.
Walser hat über seine Schriftstellerei mal gesagt, sie bestehe in dem Versuch »etwas so schön zu sagen, wie es noch nicht ist«. Genau diese Einsicht wendet er jetzt auf die Theologie an – schon in »Mein Jenseits« heißt es »der Glauben mache die Welt schöner als das Wissen.« Und: »Glauben heißt die Welt so schön machen, wie sie nicht ist.« Jetzt heißt es: gelungene Theologie sei eigentlich Dichtung. »Karl Barths Sprache ist nicht weniger Dichtung als die Sprache Nietzsches. Aber beide erinnern an eine Zeit, in der es den Unterschied zwischen Dichtung und Religion nicht gab. Die Psalmen. Das Alte und das Neue Testament«.
Barth tanze genauso mit den Wörtern wie Zarathustra, aber es ist ein Tanz mit der Negation, »ein dialektischer Tanz«, aufgelöst in Bewegung, ins Umkreisen der Gnade, ins Erlebbar machen, dass uns etwas fehlt. Das ist eine wichtige Einsicht – Theologie als über etwas klug reden geht an den Menschen und ihren existentiellen Fragen vorbei, man muss in etwas sein und reden. Das fehlt in der Theologie von heute oft. Diese Dimension erreichen Filme eher (etwa Lars von Triers Breaking the Waves oder Melancholia).
Walser Begeisterung für den frühen Barth ist nachvollziehbar. Den mittleren Barth mit der nicht enden wollenden Suada seiner Kirchlichen Dogmatik, einen Regalmeter breit, und seinem Offenbarungspositivismus blendet er völlig aus. Da müsste er soviel lesen, dass er selbst nicht mehr zum Schreiben käme. Allerdings irrt Walser, wenn er meint, Barth sei der Kirchenvater unserer Zeit und nicht mehr Schleiermacher. Es ist genau umgekehrt – die klugen liberalen Theologen von heute gehen wieder von Schleiermacher aus. Von seinem »Glaube sei Geschmack für das Unendliche«, der sich in allen möglichen kulturellen Produktionen zeigt, die von den Theologen mit Fleiß analysiert werden. Denen aber der Hunger nach Gott, die Sehnsucht nach Rechtfertigung verloren gegangen ist.
Walser gibt bekannt (denn ursprünglich war der Text eine an der Harvard University 2011 gehaltene Rede), er möchte am Freitag um 13 Uhr ein Seminar anbieten, das sich mit diesen Fragen beschäftigt und in dem vor allem Barth und Nietzsche gelesen werden sollen. Ich melde mich virtuell für dies Seminar an und werde als erstes wieder zum Römerbrief- Kommentar Barths greifen. Und dann möchte ich mit Walser darüber diskutieren, was die gesellschaftlichen Ursachen dieses Nichtfragens nach Rechtfertigung , dieses Zufriedenseins mit dem Rechthabenwollen sind.
Fehlt uns die Not der Figuren Dostojewskis und Kafkas? Und ist diese Rechtfertigung bei uns versteckt beantwortet in der ästhetischen Produktion(so wie schon Nietzsches sagte, die Welt sei »allein als ästhetisches Phänomen gerechtfertigt«, etwa durch den Ton eines Dudelsacks, die Musik)? Und bei denen, die im gesellschaftlichen Unten sind, ist sie da stillgelegt durch die Allgegenwart der Massenmedien, die unterhaltsam ablenken? Oder ist die Zeit einer expressiv-dichterischen Gottsuche vorbei und zeigt sich existentiell nur noch in fragwürdigen Fundamentalismen?


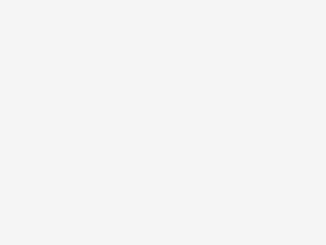
Hinterlasse jetzt einen Kommentar