

Jaja, wer Lyrik schreibt, ist erst ein echter Dichter, ein Poet und das richtig. Der Hamburger Überdichter Peter Rühmkorf titelte einst mit seiner Verrücktheit und war in den 70ern, so ganz SPD-nah, mit dem schwadronierendsten aller Jazz-Redakteure, Michael Naura, unterwegs. Das hatte Erfolg und war teilpolitisch und teilpoetisch. Die Zeiten sind vorbei, wobei der eine oder andere Bildunsgbürger oder Bildungsbürgernachahmer – der vor allem – das hohe Lied des extemporierten Vortrags singt. Kinder, lernt Gedichte! – wenn’s denn Pisa dient.
So richtig ist die Poesie nicht mehr vorhanden im Volk der Dichter und Denker, bei Lyrik denkt die digitale Moderne dann doch lieber an Lyrics und googelt mal schnell die Verse nach, die der gerade so fulminante Popularkünstler verzapft hat. Denn Lyrik ist schwer und dräuend und von Göthe und Schiller; wenn’s hoch kommt, noch die »Brück am Tay«. Höchstens. In der Nische blüht ein Celanzweig. Aber das ist eben schwer und was für den Literaturkreis.
Warum soll man denn dann heute ein Buch kaufen, auf dem ziemlich versteckt der Hinweis auf »Gedichte« gedruckt ist? Weil sie eben doch noch gibt, die Poeten, die mehr als die Liedstrophe beherrschen, die singen können, ohne zu trällern, und die Geschichten erzählen können. Matthias Göritz schmaler Band »Tools« (eine gewisse Vorliebe für den englischen Doppellaut ist da zu erkennen, so gibt es außerdem das anagrammatische Titelpärchen »Loops« (2001) und »Pools« (2006)) ist so einer, den man lohnend kaufen könnte. Denn hier spricht ein deutscher Dichter, tief verwurzelt in der Tradition und angekommen in der Moderne.
Wie das geht? Da gibt es viereinhalb Abschnitte, Kapitel – einer davon heißt »Automobile«. 15 Gedichte, die Geschichte eines Liebespaares auf der Reise durch Europa. Kein gewöhnliches Paar, ein Autoknackerpärchen, jeder Ort ein anderes Fahrzeug, jedes Mal eine andere Art, dessen Schutz aufzuheben, ein anderes Tool:
I. Audi A2
Wagen der Schwester, Neujahr, Königstein, Taunus, Polenschlüssel
Automobile: ein zittriger Anfang. Immer denken
dass ich die überall küssen will. […]
Ein Spiel mit einem Genre, Roadmovie, À bout de soufflé, das Autoradio und das Lied, das zur Stimmung passen mag, ein Kommentar:
Haut nackt im Niesel. Die Liebe macht uns stumm.
Anderes Lied: I once fell in love with you
just beacuse the sky turned off from grey into blue […]
Die Geschichte geht weiter und mit ihr die Fragen an die Geliebte und an das Leben, Zweifeln und Hoffen sind implizit:
Eifersucht ist schnell auf dem Radarschirm.
Miss mich nicht. Vermiss mich. Kauern
im Schatten des Schiebedachs, Sommerflimmern
Das sind Gedichte mit narrativem Moment, Innenschau ohne Verklärung und mit einem gleichermaßen innigen wie kraftvollem Momentum versehen. Und sie sind in eine höchst kunstvolle Form gegossen – ein Sonettenkranz, klassischer geht es kaum, 14 Sonette und das abschließende »Meistersonett«, das sich aus den Schlusszeilen der vorangehenden Reihe bildet.
Göritz wählt die petrarkische Urform dieses Typus, bestehend aus je zwei Vierzeilern und zwei Dreizeilern und geht damit weit zurück in der europäischen Tradition. Trotz aller Form ist das Ganze immer wieder als ein Spiel zu betrachten, eine gewisse Verliebtheit in die Virtuosität die Form zu beherrschen, ist dem Autor nie abzusprechen. Er hat sichtlich Freude an diesem Zusammenschluss zwischen Tradition und Moderne.
Ebenso auffallend wie diese stilistische Sicherheit ist die thematische Öffnung des europäischen Begriffs. Göritz ist ein umtriebiger Reisender, im realen Leben und in seinen Gedichten. Er ist nicht nur in Petrarcas Italien zu Hause, sein Europa hört auch nicht in Frankfurt/Oder auf. All die alten Verbindungen sind da präsent, Polen, Deutschland, Frankreich, die Gemeinsamkeit einer vielhundertjährigen und oft auch fürchterlichen Historie.
In Berceuse Des-Dur op. 57, einem dieser Erinnerungsstücke, heißt es:
schreibt er seine mysteriöseste (schönste)
Musik (die Berceuse)
Vielleicht ist etwas von George Sand in ihr.
Wie wenig unterscheiden sich die Zeiten,
wie sehr.
Und:
Es ist seltsam, wie in der Geschichte,
der prosaischsten aller Zurichtungsformen,
das Herz auftaucht, das komplizierteste Wort der Poesie.
Das ist ein Credo und auch ein tiefer Kernsatz dieser Lyrik, der die Verbindung von wahrgenommenem und erlebtem Leben – auch im ungefähren – in diesem Werk verankert. Das das nicht immer dräuend, schwer oder belehrend sein muss, sondern auch mit florettierendem Charme, liest man dann hier:
Du warst so schön wie ein Bild,
das gerade im Schloss hing, die Dame
mit dem Hermelin von Da Vinci, nur du
warst die ohne. Ohne
konnte man einfach mehr
sehn.
Ein deutscher Dichter, ein europäischer Dichter und ein politischer Dichter.
So ist es gut. [space size=90]
Matthias Göritz: Tools. Gedichte
Berlin Verlag [Amazon Partnerlink]



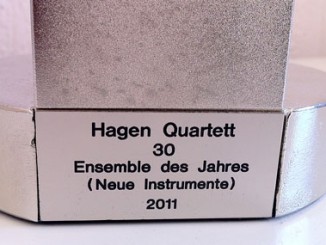
Hinterlasse jetzt einen Kommentar